Cornelius Hell, Lesezeichen & Lebenszeiten
 Wie Lymphe ist in der Literatur neben den Texten ein zweiter Kreislauf angelegt, gleichsam ein Immun- und Heilsystem, worin all die Rezensionen und Lebenserfahrungen beim Lesen als echte Bücher vertrieben werden. Es macht nämlich einen profunden Unterschied, ob die Begleitliteratur knapp an der Grenze zum Alltagsgeschehen publiziert wird oder als Fließtext, der sich quasi über das Leben der Rezensierenden spannt.
Wie Lymphe ist in der Literatur neben den Texten ein zweiter Kreislauf angelegt, gleichsam ein Immun- und Heilsystem, worin all die Rezensionen und Lebenserfahrungen beim Lesen als echte Bücher vertrieben werden. Es macht nämlich einen profunden Unterschied, ob die Begleitliteratur knapp an der Grenze zum Alltagsgeschehen publiziert wird oder als Fließtext, der sich quasi über das Leben der Rezensierenden spannt.
Cornelius Hell nennt sich selbst einen öffentlichen Leser, sein literarisches Leben lang nämlich ist er unterwegs, im öffentlichen Raum über Presse und Rundfunk den Diskurs über das Leben am Laufen zu halten. Was dabei in seinem Lektüre-Inneren vorgeht hat er in einem dichten Band mit den vier Begriffen zusammengefasst: Lese-Zeichen-Lebens-Zeiten.

 Bücher, die ein extrem peripheres Sachgebiet abdecken, werden durch KI mittlerweile an den Mainstream angedockt, indem sachkundiges Bibliothekspersonal die entsprechenden Schlüsselbegriffe vernetzt. So tauchen scheinbar marginale Thesen eines Buches überraschend als Treffer an ganz anderer Stelle auf, wenn sie von einer Suchfunktion im Netz angesteuert werden.
Bücher, die ein extrem peripheres Sachgebiet abdecken, werden durch KI mittlerweile an den Mainstream angedockt, indem sachkundiges Bibliothekspersonal die entsprechenden Schlüsselbegriffe vernetzt. So tauchen scheinbar marginale Thesen eines Buches überraschend als Treffer an ganz anderer Stelle auf, wenn sie von einer Suchfunktion im Netz angesteuert werden.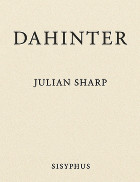 Im Daumenkino wird mit dem Daumen ein Packen Papier durchgeblättert, auf dem wie durch die Kader eines Filmes minimale Bewegungsabläufe sichtbar werden. Julian Sharp greift für seine Erzählung „Dahinter“ diese Idee auf, nur dass bei ihm die Bewegung existenziell sichtbar wird. Statt der gezeichneten Bilder verwendet er monomane Sätze, die die erzählte Geschichte wie die Spitzen einer Choreographie sichtbar werden lassen.
Im Daumenkino wird mit dem Daumen ein Packen Papier durchgeblättert, auf dem wie durch die Kader eines Filmes minimale Bewegungsabläufe sichtbar werden. Julian Sharp greift für seine Erzählung „Dahinter“ diese Idee auf, nur dass bei ihm die Bewegung existenziell sichtbar wird. Statt der gezeichneten Bilder verwendet er monomane Sätze, die die erzählte Geschichte wie die Spitzen einer Choreographie sichtbar werden lassen. Sobald man das Mittelmaß von etwas zu ermitteln versucht, treten die Extreme und Extravaganzen unkündbar in den Vordergrund. Ein durchschnittliches Leben zu ermitteln, führt in der Literatur verlässlich zu einem Heldenepos, in dem sich die Protagonisten nicht gegen ihre wahrhaftige Bedeutung zur Wehr setzen können.
Sobald man das Mittelmaß von etwas zu ermitteln versucht, treten die Extreme und Extravaganzen unkündbar in den Vordergrund. Ein durchschnittliches Leben zu ermitteln, führt in der Literatur verlässlich zu einem Heldenepos, in dem sich die Protagonisten nicht gegen ihre wahrhaftige Bedeutung zur Wehr setzen können. Gegen Jahresende greift man die Bücher mit besonderer Ehrfurcht an, allzu oft überfällt einen dabei das letzte Aufzucken einer Epoche, von der man noch einen Zipfel Aktualität ergattert.
Gegen Jahresende greift man die Bücher mit besonderer Ehrfurcht an, allzu oft überfällt einen dabei das letzte Aufzucken einer Epoche, von der man noch einen Zipfel Aktualität ergattert. Mit fünfzig hält ein sensibler Künstler meist öffentlich inne, um sein Werkeln zu reflektieren und seinem Publikum fallweise darzulegen, welche Entwicklungskurven seine Kunst genommen hat. Denn in der Kunst ist nichts geradlinig.
Mit fünfzig hält ein sensibler Künstler meist öffentlich inne, um sein Werkeln zu reflektieren und seinem Publikum fallweise darzulegen, welche Entwicklungskurven seine Kunst genommen hat. Denn in der Kunst ist nichts geradlinig. Widerstand, Eigenart und Selbstbewusstsein der Südtiroler resultieren aus dem täglichen Überlebenskampf des Individuums inmitten der Massen. Josef Oberhollenzer zeigt in seinen Romanen immer wieder, dass es sich lohnt, ein Individuum zu sein. Denn es sind immer die Massen, die einsam sind, ‒ die Einzelgänger sind nämlich umkost von Kunst und Literatur.
Widerstand, Eigenart und Selbstbewusstsein der Südtiroler resultieren aus dem täglichen Überlebenskampf des Individuums inmitten der Massen. Josef Oberhollenzer zeigt in seinen Romanen immer wieder, dass es sich lohnt, ein Individuum zu sein. Denn es sind immer die Massen, die einsam sind, ‒ die Einzelgänger sind nämlich umkost von Kunst und Literatur. Große Ereignisse schicken in der Mythologie oft Kometen als Vorboten, damit die Menschen nach oben schauen und wach werden für das Neue, das nun über sie herfällt.
Große Ereignisse schicken in der Mythologie oft Kometen als Vorboten, damit die Menschen nach oben schauen und wach werden für das Neue, das nun über sie herfällt. Manche Bücher verhexen das Fachpublikum mit ihren schlauen neuen Erzählstrategien, andere wirken auf das alltägliche Sprechgeschehen ein wie der sprichwörtliche Gassenhauer für einfache Handgriffe.
Manche Bücher verhexen das Fachpublikum mit ihren schlauen neuen Erzählstrategien, andere wirken auf das alltägliche Sprechgeschehen ein wie der sprichwörtliche Gassenhauer für einfache Handgriffe. Das Unerfüllbare / fülle ich / mit Unerfüllbarem. (16) ‒ Selten ist die Absicht der Lyrik so klar formuliert wie in der „Stunde der Wintervögel“. Dieser magische Titel kreist scheinbar um das gängige Hauptmotiv der Gegenwartslyrik, den Vögeln, in Wirklichkeit aber ist ein poetischer Teppich über das Land gelegt, aus dem wie in alten Zeiten des Teppich-Klopfens Gebrauchspartikel der unmittelbaren Gegenwart geschüttelt werden.
Das Unerfüllbare / fülle ich / mit Unerfüllbarem. (16) ‒ Selten ist die Absicht der Lyrik so klar formuliert wie in der „Stunde der Wintervögel“. Dieser magische Titel kreist scheinbar um das gängige Hauptmotiv der Gegenwartslyrik, den Vögeln, in Wirklichkeit aber ist ein poetischer Teppich über das Land gelegt, aus dem wie in alten Zeiten des Teppich-Klopfens Gebrauchspartikel der unmittelbaren Gegenwart geschüttelt werden.