Stefan Soder, Schorsch
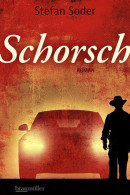 Wenn die Stimmung im Land wieder einmal bedrückend wird, hilft manchmal ein Roman nach der Vorlage von Kleists Michael Kohlhaas, damit man sich mit dem Helden identifizieren, mit ihm kämpfen und mit ihm in Würde untergehen kann.
Wenn die Stimmung im Land wieder einmal bedrückend wird, hilft manchmal ein Roman nach der Vorlage von Kleists Michael Kohlhaas, damit man sich mit dem Helden identifizieren, mit ihm kämpfen und mit ihm in Würde untergehen kann.
Stefan Soder stiftet der Literatur mit dem „Schorsch“ einen sympathischen Helden, der in einer Welt des wirtschaftlichen Umbruchs mit der bewährten Tradition des Bauer-Seins Schiffbruch erleidet. Der Plot ist speedy wie das Netz, ständig zweigen aus dem Hauptstrang elementare Reibereien ab, die den Roman in seiner Dramaturgie bald zu einem gedachten Film werden lassen, den weder Personal noch Regie stoppen können.

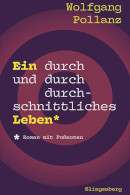 Sobald man das Mittelmaß von etwas zu ermitteln versucht, treten die Extreme und Extravaganzen unkündbar in den Vordergrund. Ein durchschnittliches Leben zu ermitteln, führt in der Literatur verlässlich zu einem Heldenepos, in dem sich die Protagonisten nicht gegen ihre wahrhaftige Bedeutung zur Wehr setzen können.
Sobald man das Mittelmaß von etwas zu ermitteln versucht, treten die Extreme und Extravaganzen unkündbar in den Vordergrund. Ein durchschnittliches Leben zu ermitteln, führt in der Literatur verlässlich zu einem Heldenepos, in dem sich die Protagonisten nicht gegen ihre wahrhaftige Bedeutung zur Wehr setzen können.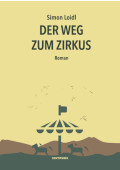 Ein echter Zirkus verwandelt jene Glücksvorstellungen, die im Laufe einer Kindheit aufgekeimt sind, in raren Fällen bei Erwachsenen zu einem realen Paradies. Der Weg zum Zirkus ist jedenfalls wie die meisten Bildungswege holprig und absonderlich.
Ein echter Zirkus verwandelt jene Glücksvorstellungen, die im Laufe einer Kindheit aufgekeimt sind, in raren Fällen bei Erwachsenen zu einem realen Paradies. Der Weg zum Zirkus ist jedenfalls wie die meisten Bildungswege holprig und absonderlich.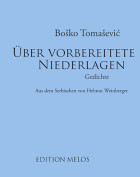 Was ist das wohl für ein seltsames Angebot, sich auf Niederlagen vorzubereiten, oder das Vorbereitete als Niederlage wahrzunehmen? Boško Tomašević stellt sein Thema ungeschminkt in die literarischen Schaufenster und Bibliotheksregale, wenn er auf den Grundton seiner Gedichte verweist, die er als 56 Gesänge komponiert hat. ‒ In seinen Langgedichten herrscht ein elegisch-existenzielles Regime, dem das Ich hoffnungslos ausgesetzt ist.
Was ist das wohl für ein seltsames Angebot, sich auf Niederlagen vorzubereiten, oder das Vorbereitete als Niederlage wahrzunehmen? Boško Tomašević stellt sein Thema ungeschminkt in die literarischen Schaufenster und Bibliotheksregale, wenn er auf den Grundton seiner Gedichte verweist, die er als 56 Gesänge komponiert hat. ‒ In seinen Langgedichten herrscht ein elegisch-existenzielles Regime, dem das Ich hoffnungslos ausgesetzt ist. Mit fünfzig hält ein sensibler Künstler meist öffentlich inne, um sein Werkeln zu reflektieren und seinem Publikum fallweise darzulegen, welche Entwicklungskurven seine Kunst genommen hat. Denn in der Kunst ist nichts geradlinig.
Mit fünfzig hält ein sensibler Künstler meist öffentlich inne, um sein Werkeln zu reflektieren und seinem Publikum fallweise darzulegen, welche Entwicklungskurven seine Kunst genommen hat. Denn in der Kunst ist nichts geradlinig.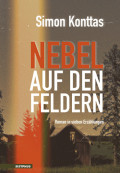 Bilder als Titel lösen spontan Sehnsüchte aus, die sich aus Musik und Literatur zu einem bestimmten Thema aufgestaut haben. Sobald „Nebel auf den Feldern“ als Cover vor den Leseaugen auftaucht, beginnt eine Musik nach finnischer Art zu erklingen, die Landschaft wird weit und „finnisch“, und wenn sich dann noch der Nebel auf die Felder legt, beginnen die Seelen der Bewohner zu flirren, deren Schicksale von einem wechselnden Schleier an Stimmung zusammengehalten werden.
Bilder als Titel lösen spontan Sehnsüchte aus, die sich aus Musik und Literatur zu einem bestimmten Thema aufgestaut haben. Sobald „Nebel auf den Feldern“ als Cover vor den Leseaugen auftaucht, beginnt eine Musik nach finnischer Art zu erklingen, die Landschaft wird weit und „finnisch“, und wenn sich dann noch der Nebel auf die Felder legt, beginnen die Seelen der Bewohner zu flirren, deren Schicksale von einem wechselnden Schleier an Stimmung zusammengehalten werden. Wie Sand im Stundenglas pendelt jedes Gedicht zwischen Theorie und Anwendung hin und her und häuft dabei Zeit als Gutschrift für die Ewigkeit an.
Wie Sand im Stundenglas pendelt jedes Gedicht zwischen Theorie und Anwendung hin und her und häuft dabei Zeit als Gutschrift für die Ewigkeit an.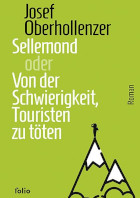 Widerstand, Eigenart und Selbstbewusstsein der Südtiroler resultieren aus dem täglichen Überlebenskampf des Individuums inmitten der Massen. Josef Oberhollenzer zeigt in seinen Romanen immer wieder, dass es sich lohnt, ein Individuum zu sein. Denn es sind immer die Massen, die einsam sind, ‒ die Einzelgänger sind nämlich umkost von Kunst und Literatur.
Widerstand, Eigenart und Selbstbewusstsein der Südtiroler resultieren aus dem täglichen Überlebenskampf des Individuums inmitten der Massen. Josef Oberhollenzer zeigt in seinen Romanen immer wieder, dass es sich lohnt, ein Individuum zu sein. Denn es sind immer die Massen, die einsam sind, ‒ die Einzelgänger sind nämlich umkost von Kunst und Literatur.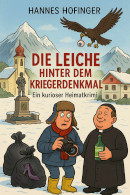 In der naiven Malerei sind die Grenzen zwischen Handwerk, Kunst, Autodidaktik und Akademie aufgehoben. Was als schlichte künstlerische Äußerung erscheint, ist in Wirklichkeit eine Handhabung der Realität unter dem Filter der Lebenserfahrung.
In der naiven Malerei sind die Grenzen zwischen Handwerk, Kunst, Autodidaktik und Akademie aufgehoben. Was als schlichte künstlerische Äußerung erscheint, ist in Wirklichkeit eine Handhabung der Realität unter dem Filter der Lebenserfahrung. Manche Bücher verhexen das Fachpublikum mit ihren schlauen neuen Erzählstrategien, andere wirken auf das alltägliche Sprechgeschehen ein wie der sprichwörtliche Gassenhauer für einfache Handgriffe.
Manche Bücher verhexen das Fachpublikum mit ihren schlauen neuen Erzählstrategien, andere wirken auf das alltägliche Sprechgeschehen ein wie der sprichwörtliche Gassenhauer für einfache Handgriffe.