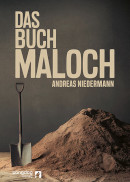 Andreas Niedermann arbeitet sich mit seinem Erzählband „Das Buch Maloch“ an allem ab, was direkt oder indirekt mit Arbeit zu tun hat. Mit diesem Unterfangen gleicht er dem großen soziologischen Projekt „Geschichte und Eigensinn“, worin Alexander Kluge und Oskar Negt 1981 eine ganze Generation von Arbeitern und Denkern in Atem gehalten haben.
Andreas Niedermann arbeitet sich mit seinem Erzählband „Das Buch Maloch“ an allem ab, was direkt oder indirekt mit Arbeit zu tun hat. Mit diesem Unterfangen gleicht er dem großen soziologischen Projekt „Geschichte und Eigensinn“, worin Alexander Kluge und Oskar Negt 1981 eine ganze Generation von Arbeitern und Denkern in Atem gehalten haben.
Das Buch Maloch geht als Erzählungssammlung von einer Idealbiographie aus, worin ein paradigmatischer Ich-Erzähler so alles durchlebt, was sich durch ständigen Berufswechsel, durch Abgrasen prekärer Arbeitsfelder und durch Vermeidungsstrategien von Arbeit erleben lässt. Dieser chronologisch erzählende Arbeitende durchlebt quasi in 32 Stationen das in Anwendung, was im fetten „Geschichte und Eigensinn“ auf über tausend Seiten gezeichnet und geschrieben steht.
Dabei wird die Haupterkenntnis klug zu einem Sprichwort geschrumpft:
„Der Sinn der Arbeit liegt in der Vermeidung.“ (156)
Die Abenteuer des Erzählers weisen Elemente eines Schelmenromans auf, wenn der Held besonders pfiffig zu einer Arbeit gekommen ist oder dieser gerade noch auskommen kann. Es kommen düstere psychische Dellen zum Vorschein, wenn sich die Arbeit wie ein bleierner Ring auf die Seele legt. Aber es spült auch sozialistische Romantik in die Speichen des Getriebes, wenn sich das Arbeitswerkl rund um den Werktätigen ordentlich dreht.
Eingerahmt ist die Arbeit von zwei Schlüsselszenen. Zu Beginn erhebt sich beim Mähen einer Steilwiese die Frage, ob das Zuarbeiten zum Bienenvolk noch Arbeit ist. Immerhin geht der Tag müde und erfüllt in ein Glas Wein über. – Und im Kontrast dazu ist das Ende düster, indem sich aus dem Begriff „Burnout“ so etwas wie ein Heizer von Kafkaeskem Ausmaß entwickelt, der das Höllenfeuer in Gang hält.
Dazwischen blitzt die Arbeit der Mutter zu Hause auf, wenn das Kind ihren Verrichtungen zusieht voller Magie. Später arbeitet das Kind mit, ohne etwas vom Unwort Kinderarbeit zu ahnen.
Der altkluge Pubertierende wird mit dem Genie-Begriff Arthur Rimbauds vertraut gemacht und beschließt, das Handwerk generell zu verachten, obwohl er in den Ferien als Handlanger diesem Handwerk zuarbeitet, aber immerhin als Genie getarnt.
Ein Stall zeigt sich als Urform des Förderbands, wenn die Tiere bei „laufendem Verdauungsbetrieb“ vorne gefüttert und hinten gereinigt werden müssen.
Die erste Stechuhr des Arbeiters empfindet dieser meist als Tattoo, das ihn als Mitglied einer bestimmten malochenden Gang erkennbar macht.
„Ein Schweizer geht nicht stempeln.“ – Auch so ein Satz, der sich im Alltag nicht bewährt. Der Held erlebt am Arbeitsamt geradezu klassische Demütigungen.
Wer ständig auf der Suche nach Arbeit ist, findet zwischendurch Raritäten für seine Biographie. In der Büchermenschstory (60) geht es darum, die edlen Bücher des Suhrkamp-Verlags am Land auszuliefern.
Heikle Arbeitsverhältnisse müssen fallweise durch ein Gericht geklärt werden. Das Wort Arbeitsprozess erfährt einen neuen Sinn. Der Held hat dabei doppeltes Glück. Zum einen weiß er nicht, wie er zu diesem Prozess gekommen ist. Zum anderen gewinnt er und erlebt einen Prozessgegner am Rande seiner Selbstkontrolle.
Selbst das Aufblättern der Familiengeschichte endet immer bei einer bestimmten Form von Arbeit, oft weiß man von den Vorfahren nichts außer ihrem Beruf.
Allmählich kristallisiert sich heraus, dass unter Arbeit eine besondere Form der Haltung gemeint sein könnte. Das hebräische Wort Maloch für Arbeit lässt auch jene Deutung offen, wonach die Arbeit überhaupt unter einem religiösen Aspekt zu sehen sei. Die einzelnen Kapitel könnten dann wie Arbeiterlegenden gelesen werden. Und tatsächlich steckt in den Geschichten viel didaktisches Geschick, die oft ungemütliche Work-Life-Balance ironisch vorzutragen.
Andreas Niedermann, Das Buch Maloch
Bern: Songdog Verlag 2024, 164 Seiten, 20,00 €, ISBN 978-3-903349-28-5
Weiterführende Links:
Songdog Verlag: Andreas Niedermann, Das Buch Maloch
Wikipedia: Andreas Niedermann
Helmuth Schönauer, 15-11-2024
