Stefan Soder, Schorsch
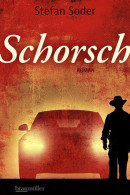 Wenn die Stimmung im Land wieder einmal bedrückend wird, hilft manchmal ein Roman nach der Vorlage von Kleists Michael Kohlhaas, damit man sich mit dem Helden identifizieren, mit ihm kämpfen und mit ihm in Würde untergehen kann.
Wenn die Stimmung im Land wieder einmal bedrückend wird, hilft manchmal ein Roman nach der Vorlage von Kleists Michael Kohlhaas, damit man sich mit dem Helden identifizieren, mit ihm kämpfen und mit ihm in Würde untergehen kann.
Stefan Soder stiftet der Literatur mit dem „Schorsch“ einen sympathischen Helden, der in einer Welt des wirtschaftlichen Umbruchs mit der bewährten Tradition des Bauer-Seins Schiffbruch erleidet. Der Plot ist speedy wie das Netz, ständig zweigen aus dem Hauptstrang elementare Reibereien ab, die den Roman in seiner Dramaturgie bald zu einem gedachten Film werden lassen, den weder Personal noch Regie stoppen können.

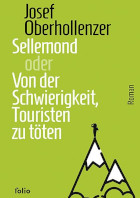 Widerstand, Eigenart und Selbstbewusstsein der Südtiroler resultieren aus dem täglichen Überlebenskampf des Individuums inmitten der Massen. Josef Oberhollenzer zeigt in seinen Romanen immer wieder, dass es sich lohnt, ein Individuum zu sein. Denn es sind immer die Massen, die einsam sind, ‒ die Einzelgänger sind nämlich umkost von Kunst und Literatur.
Widerstand, Eigenart und Selbstbewusstsein der Südtiroler resultieren aus dem täglichen Überlebenskampf des Individuums inmitten der Massen. Josef Oberhollenzer zeigt in seinen Romanen immer wieder, dass es sich lohnt, ein Individuum zu sein. Denn es sind immer die Massen, die einsam sind, ‒ die Einzelgänger sind nämlich umkost von Kunst und Literatur.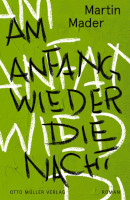 Wer das erste Mal durch Zufall oder als Geheimtipp in das Darknet geraten ist, wird hinterher nur schwer beschreiben können, was er darin gesehen hat. Martin Mader entführt mit dem Roman „Am Anfang wieder die Nacht“ die Leser in ein Darknet, worin alles vorkommt, was man sich in einer Gegenwelt erwarten möchte: Dunkelheit, Exzesse, Geld, Drogen, Waffen, Verschwörungen, Geschäfte.
Wer das erste Mal durch Zufall oder als Geheimtipp in das Darknet geraten ist, wird hinterher nur schwer beschreiben können, was er darin gesehen hat. Martin Mader entführt mit dem Roman „Am Anfang wieder die Nacht“ die Leser in ein Darknet, worin alles vorkommt, was man sich in einer Gegenwelt erwarten möchte: Dunkelheit, Exzesse, Geld, Drogen, Waffen, Verschwörungen, Geschäfte.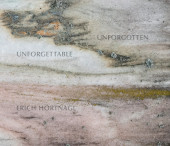 Was immer das Leben unvergessen machen kann, es gleicht einer Sanduhr, die ein paar Mal gedreht wird, ehe der Sand in der Zeit verschwunden ist.
Was immer das Leben unvergessen machen kann, es gleicht einer Sanduhr, die ein paar Mal gedreht wird, ehe der Sand in der Zeit verschwunden ist.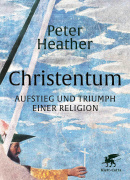 „Die christliche Religion, der Konstantin die Treue schwor, hatte wenig Ähnlichkeit mit der ausdifferenzierten, monolithischen religiös-kulturellen Struktur, die sich bis zum 12. und 13. Jahrhundert herausgebildet hatte und die dann die überwiegende Mehrheit der unterschiedlichen Landschaften und Bevölkerungen Europas beherrschte, bis die Reformation in den 1500er Jahren ernsthaft Fuß fasste. Die Entstehung dieser außergewöhnlichen, voll ausgereiften Struktur soll im Mittelpunkt des vorliegenden Buches stehen.“ (S. 12)
„Die christliche Religion, der Konstantin die Treue schwor, hatte wenig Ähnlichkeit mit der ausdifferenzierten, monolithischen religiös-kulturellen Struktur, die sich bis zum 12. und 13. Jahrhundert herausgebildet hatte und die dann die überwiegende Mehrheit der unterschiedlichen Landschaften und Bevölkerungen Europas beherrschte, bis die Reformation in den 1500er Jahren ernsthaft Fuß fasste. Die Entstehung dieser außergewöhnlichen, voll ausgereiften Struktur soll im Mittelpunkt des vorliegenden Buches stehen.“ (S. 12)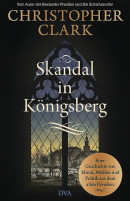 „Zwischen 1835 und 1842 braute sich in Königsberg ein Skandal um zwei Geistliche zusammen. Ihr Ruf wurde ruiniert, sie verloren ihre Stelle, kamen ins Gefängnis und wurden aus dem öffentlichen Leben verbannt. Die juristische Entlastung von den schwersten Anklagen, die man gegen sie vorgebracht hatte, kam zu spät, um den Schaden wiedergutzumachen.“ (S. 9)
„Zwischen 1835 und 1842 braute sich in Königsberg ein Skandal um zwei Geistliche zusammen. Ihr Ruf wurde ruiniert, sie verloren ihre Stelle, kamen ins Gefängnis und wurden aus dem öffentlichen Leben verbannt. Die juristische Entlastung von den schwersten Anklagen, die man gegen sie vorgebracht hatte, kam zu spät, um den Schaden wiedergutzumachen.“ (S. 9)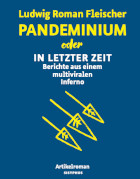 Die wahren Helden der Zeitgeschichte sind oft Medien, die sich mit einem kleinen Taschenmesser einen Weg durch den Dschungel der Meinungen schlagen. Dabei liegt die wahre Regierung über den kleinteiligen Zeitgeist meist als Impressum einer unscheinbaren Kleinzeitung auf.
Die wahren Helden der Zeitgeschichte sind oft Medien, die sich mit einem kleinen Taschenmesser einen Weg durch den Dschungel der Meinungen schlagen. Dabei liegt die wahre Regierung über den kleinteiligen Zeitgeist meist als Impressum einer unscheinbaren Kleinzeitung auf.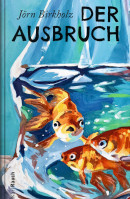 Das Wort „plötzlich“ leitet in der Literatur oft einen Ausbruch ein. Kluge Leser wissen das und blättern im Roman oft von plötzlich zu plötzlich, damit ihnen ja kein Ausbruch als Vulkan, Seuche oder Lebensplanung entgeht.
Das Wort „plötzlich“ leitet in der Literatur oft einen Ausbruch ein. Kluge Leser wissen das und blättern im Roman oft von plötzlich zu plötzlich, damit ihnen ja kein Ausbruch als Vulkan, Seuche oder Lebensplanung entgeht.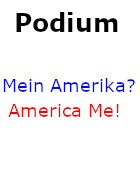 Zumindest in der Literatur, sagt man, kann es Austria mit Amerika aufnehmen. Und dann werden gleich wuchtige Beispiele von Kürnberger, Kafka, Roth und Handke genannt, worin von Europa aus ein kontinentales Weltbild von Amerika entwickelt worden ist.
Zumindest in der Literatur, sagt man, kann es Austria mit Amerika aufnehmen. Und dann werden gleich wuchtige Beispiele von Kürnberger, Kafka, Roth und Handke genannt, worin von Europa aus ein kontinentales Weltbild von Amerika entwickelt worden ist.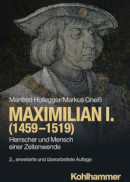 „Um der ganzen Welt zu beweisen, dass die Habsburger das »das edelste Blut im Himmel und auf Erden seien«, ließ Maximilian durch seine Genealogen umfangreiche Stammbaumforschungen durchführen. Auftragsgemäß führten diese die habsburgische Dynastie auf die Staufer, Ottonen und Karolinger, bis auf die Trojaner und – vom Kaiser später allerdings wieder verworfen – bis auf Noah zurück.“ (S. 11)
„Um der ganzen Welt zu beweisen, dass die Habsburger das »das edelste Blut im Himmel und auf Erden seien«, ließ Maximilian durch seine Genealogen umfangreiche Stammbaumforschungen durchführen. Auftragsgemäß führten diese die habsburgische Dynastie auf die Staufer, Ottonen und Karolinger, bis auf die Trojaner und – vom Kaiser später allerdings wieder verworfen – bis auf Noah zurück.“ (S. 11)