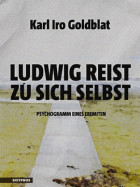 Das Aufregende am Reisen ohne Wiederkehr besteht darin, dass man mit einem einzigen Besuch im Reisebüro auskommt. Reklamationen und Schadensmeldungen sind keine Optionen, weil es keinen Vollstreckungsort gibt, außer im Innersten seiner selbst.
Das Aufregende am Reisen ohne Wiederkehr besteht darin, dass man mit einem einzigen Besuch im Reisebüro auskommt. Reklamationen und Schadensmeldungen sind keine Optionen, weil es keinen Vollstreckungsort gibt, außer im Innersten seiner selbst.
Karl Iro Goldblat erzählt von einem gewissen Ludwig, der eine Einwegreise zu sich selbst antritt. Dabei wird die Wohnung zu einem sich stets verdichtenden Kosmos, der den Reisenden immer dichter umhüllt, bis das Ziel, einem schwarzen Loch nicht unähnlich, erreicht ist. Der Held ist dann bei sich und implodiert.
Dieses Kammerstück der Verdichtung spielt sich auf engstem Raum innerhalb kürzester Zeit ab, man könnte von einem fulminanten Erkundungstag sprechen. Dabei gibt es für den Eremiten keinen rechten Anlass für diese Mission. „Ludwig beschließt eine Reise zu machen. Er hat keinen Plan und kein Ziel.“ (1)
In einem Story-Board der Ereignislosigkeit wird erzählt, wie es den Helden von einem Erinnerungsimpuls zum nächsten treibt, dabei fühlen sich die Textminiaturen an wie Protokolle zu einer Therapie, in der ständig mit der Namensnennung Ludwig ein kleines Abenteuer eröffnet wird.
Gleich zu Beginn zeigt Ludwig auf die Statistik seiner Haushaltstätigkeiten, die er penibel führt, als wäre er Teilnehmer eines Feldversuchs über Langeweile. Diese Hangriffe an sich und an der Wohnung sind auch das Gesamtprogramm für die Gestaltung seiner Tage, die keine Jahreszeiten kennen, kein Innen oder Außen.
Eine schlichte Assoziationskette zu den Begriffen Körperhaltung, Blutdruck, Übungen für die Gelenke erweist sich als beiläufiges Spiel eines so dahin meditierenden Menschen.
Ab und zu entsteht ein Fixpunkt, wenn die Gedanken beispielsweise auf den Lehnstuhl fokussiert sind, der sowohl als Möbel, als auch als reiner Begriff Beruhigung verspricht.
Mit der Außenwelt wird vage über das Fenster kommuniziert. Kurz kommen Sonnenstrahlen herein und bringen Erinnerungen an die Natur mit sich, die sich seinerzeit in der Kindheit des elterlichen Gartens als abgerundete Sache, wenn nicht gar Paradies erleben ließ.
In der Echtzeit der Eremiten-Tour sind freilich alle harmonischen Zusammenhänge aufgelöst. „Er kann seinen Körper als Körper wahrnehmen, aber diese Wahrnehmung ist abgespalten von ihm selbst, deswegen empfindet er auch nichts für ihn.“ (22)
In großen Kehrbewegungen schleicht Ludwig durch die Wohnung wie ein Saugroboter, der an den Bodenkanten abgelenkt und umgesteuert wird.
Die Lebensmittel sind vom Datum her verfallen, zum Teil aber auch von Maden befallen, die den Vorräten zu einer selbständigen Bewegung verhelfen. Nach dem „Lebensmittelschock“ gilt es eine Pause zu machen mit systematischem Nichtstun, ausgelöst von einem Cognac, der die Welt in einen melancholischen Wahrnehmungsbrei verwandelt.
Beim Nichtstun schweift der Blick die Bücherregale entlang, worin der Sinn des Lebens Rücken an Rücken aufgestellt ist. Die Alternative liefert der Bildschirm, der groteske Gesichter aus dem Kinderkanal zeigt und sich mit infantilen Gesten an Ludwig wendet. Wie von selbst fällt jetzt das Wort Chips, das der Dahin-Gaffende alsbald als Packung in Händen hält. Wie von selbst fällt der Name des portugiesischen Schriftstellers Fernando Pessoa, der mit seinem „Buch der Unruhe“ überall Unruhe stiftet, wo dieses Buch aufgeschlagen wird.
Die Macht der Bücher stößt im Alltag an ihre Grenzen, wenn sie nichts gegen das Grummeln im Körper ausrichten, das sich durch die Darmschlingen vorarbeitet.
Jetzt ist ein Zimmerwechsel angesagt, der Raum gleicht einem Archiv aus bunten Schachteln. Eine davon ist die Karoline-Schachtel (54), darin sind die Gadgets der ersten Liebe abgelegt. Gleich daneben steht die Friederike-Schachtel mit Erinnerungen an die tiefste Liebe des Lebens, jäh unterbrochen durch ihre Schwangerschaft ausgelöst durch einen fremden Mann. (57) Die dritte Schachtel trägt Spuren der ersten Dicht-Versuche in sich.
Auch in diesem Zimmer gibt es ein Fenster, das freilich jene diffuse Stimmung hereinlässt, die beim Anblick eines aufgelassenen Friedhofs entsteht.
Das Ende der Reise zu sich selbst muss radikal vollzogen werden, will die Reise gelingen. Das Archiv wird verändert und dabei zerstört. „Alles, was wichtig war, muss zerstört werden.“ (72) Angesichts eines Gewitters, das außen und innen gleichzeitig aufzieht, werden alle Bücher auf einen Haufen geworfen in der Hoffnung, dass der Blitz einschlägt. Die Wohnung wird leergeräumt und die Möbel durch das Fenster entsorgt.
„Das Einzige, was er noch hat, ist er selbst.“ (81)
An der Wohnungstür macht sich schweres Gerät bemerkbar, die Polizei stürmt an.
Karl Iro Goldblat lässt die Erzählung über das „Psychogramm eines Eremiten“ auf drei Ebenen wirken: Einmal ist dieser „Zellenroman“ ein Paradefall für den Tagesablauf von Menschen im Ruhestand. Zum anderen ist der Text ein wundersamer Essay über das Flanieren durch unbedeutende Devotionalien einer kleinkarierten Erinnerung. Zum dritten ist die Erzählung ein kompakter Versuch, das lange Leben voller Belanglosigkeiten in einen kompakten Eintags-Thriller zu verpacken.
Karl Iro Goldblat, Ludwig reist zu sich selbst. Psychogramm eines Eremiten. Erzählung
Klagenfurt: Sisyphus Verlag 2025, 82 Seiten, 12,80 €, ISBN 978-3-903622-03-6
Weiterführender Link:
Sisyphus Verlag: Karl Iro Goldblat, Ludwig reist zu sich selbst
Helmuth Schönauer, 25-09-2025
