Carola Rieckmann, Eigenständiges Lesen
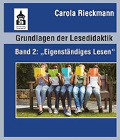 „In diesem Band soll der Blick noch einmal intensiver auf die Subjekt- und soziale Ebene der Lesekompetenz gerichtet und gefragt werden: »Was braucht man über das flüssige Dekodieren hinaus, um ein erfolgreicher Leser zu sein?«“ (1)
„In diesem Band soll der Blick noch einmal intensiver auf die Subjekt- und soziale Ebene der Lesekompetenz gerichtet und gefragt werden: »Was braucht man über das flüssige Dekodieren hinaus, um ein erfolgreicher Leser zu sein?«“ (1)
Programme wie etwa „Lautleseprogramme für die Entwicklung der Leseflüssigkeit“ oder „Lesestrategieprogramme für das Leseverstehen“ vor allem von Sachtexten trainieren zunächst grundlegende, basale Fähigkeiten für das eigenständige Lesen. „Eigenständiges Lesen“ setzt sich in Folge mit den Fähigkeiten auseinander, die über das automatisierte Wort- und Satzverständnis hinausgehen und die erst im Laufe der Zeit durch das Lesen von Texten und Lesevorbilder erlernt werden.

 „Die zentralen Ergebnisse, zu denen Hattie gekommen ist, sind in wesentlichen Teilen eigentlich banal. Aber genau darin liegt paradoxerweise der vielleicht wichtigste Beitrag seiner Arbeit: Er hat das Selbstverständliche mit solcher Wucht und so umfassend auf den Punkt gebracht, dass es künftig kaum noch möglich sein wird, die einfachen pädagogischen Wahrheiten länger zu ignorieren.“ (6)
„Die zentralen Ergebnisse, zu denen Hattie gekommen ist, sind in wesentlichen Teilen eigentlich banal. Aber genau darin liegt paradoxerweise der vielleicht wichtigste Beitrag seiner Arbeit: Er hat das Selbstverständliche mit solcher Wucht und so umfassend auf den Punkt gebracht, dass es künftig kaum noch möglich sein wird, die einfachen pädagogischen Wahrheiten länger zu ignorieren.“ (6) Der echte Marathonlauf endet mit dem Tod. Der moderne Läufer rückt diesem möglichst nah an die Pelle und überwindet ihn. Freilich bleibt eine Todessehnsucht, sodass der Marathonläufer ständig neue Läufe in das Gelände setzen muss.
Der echte Marathonlauf endet mit dem Tod. Der moderne Läufer rückt diesem möglichst nah an die Pelle und überwindet ihn. Freilich bleibt eine Todessehnsucht, sodass der Marathonläufer ständig neue Läufe in das Gelände setzen muss. Vorurteile sind nicht nur schmerzhaft ungerecht, sie sind meist auch ausgesprochen falsch. So gilt etwa in manchen Landstrichen die Brille als Zeichen für hohe Intelligenz der Trägerin, während ein sichtbares Hörgerät immer wieder die Aura von „dumm“ suggeriert.
Vorurteile sind nicht nur schmerzhaft ungerecht, sie sind meist auch ausgesprochen falsch. So gilt etwa in manchen Landstrichen die Brille als Zeichen für hohe Intelligenz der Trägerin, während ein sichtbares Hörgerät immer wieder die Aura von „dumm“ suggeriert. „»Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeitalter«, lautet unsere erste These. Paradox? Eher ein bewusster Kontrapunkt zum Digital-Diskurs, der im Moment recht einseitig in der Öffentlichkeit läuft.“ (7)
„»Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeitalter«, lautet unsere erste These. Paradox? Eher ein bewusster Kontrapunkt zum Digital-Diskurs, der im Moment recht einseitig in der Öffentlichkeit läuft.“ (7) Jedes Buch löst in der Leserschaft Reaktionen aus, aber darüber hinaus ergibt sich auch ein Wechselspiel zwischen Leseambiente und Lektüre. Ein Buch über das Sterben wirkt in einem Umfeld voller Apps wischender Kids und in Krimis blätternden Bobos geradezu elementar herausragend.
Jedes Buch löst in der Leserschaft Reaktionen aus, aber darüber hinaus ergibt sich auch ein Wechselspiel zwischen Leseambiente und Lektüre. Ein Buch über das Sterben wirkt in einem Umfeld voller Apps wischender Kids und in Krimis blätternden Bobos geradezu elementar herausragend. „Der vorliegende Band versucht daher, das breite Feld der Leistungsfeststellung zwischen Lernstandserhebung, Begutachtung und Bewertung aufzugreifen, um angehenden und praktizierenden Geschichtslehrer/innen grundlegende theoretische Einsichten und handhabbare Tools für die Unterrichtspraxis zur Verfügung zu stellen.“ (8)
„Der vorliegende Band versucht daher, das breite Feld der Leistungsfeststellung zwischen Lernstandserhebung, Begutachtung und Bewertung aufzugreifen, um angehenden und praktizierenden Geschichtslehrer/innen grundlegende theoretische Einsichten und handhabbare Tools für die Unterrichtspraxis zur Verfügung zu stellen.“ (8)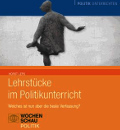 „Es ist die Absicht dieses Buches, Lehrerinnen und Lehrern mit der Lehrkunstdidaktik im Politikunterricht so weit bekannt zu machen, dass sie die vorgestellten Lehrstücke selbst ausprobieren und variieren können. Vielleicht gelingt es auch, zu neuen Lehrstücken anzuregen.“ (9)
„Es ist die Absicht dieses Buches, Lehrerinnen und Lehrern mit der Lehrkunstdidaktik im Politikunterricht so weit bekannt zu machen, dass sie die vorgestellten Lehrstücke selbst ausprobieren und variieren können. Vielleicht gelingt es auch, zu neuen Lehrstücken anzuregen.“ (9) Seit der PISA-Studie ist das Lesen in der Schule und die Diskussionen um die Lesefähigkeit und die literarischen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in das Blickfeld des öffentlichen Interesses gerückt und damit das Lesen als interdisziplinären Forschungsgegenstand etabliert.
Seit der PISA-Studie ist das Lesen in der Schule und die Diskussionen um die Lesefähigkeit und die literarischen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in das Blickfeld des öffentlichen Interesses gerückt und damit das Lesen als interdisziplinären Forschungsgegenstand etabliert.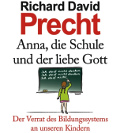 „Dieses Buch ist für Eltern geschrieben. Es möchte ihnen Argumente liefern, um gegen die bestehende Praxis aufzubegehren, die vielen von ihnen Kopfschmerzen bereitet und sie oft ohnmächtig zurücklässt.“ (10)
„Dieses Buch ist für Eltern geschrieben. Es möchte ihnen Argumente liefern, um gegen die bestehende Praxis aufzubegehren, die vielen von ihnen Kopfschmerzen bereitet und sie oft ohnmächtig zurücklässt.“ (10)