Alessandro Baricco, Smith & Wesson
 Das einzig Sinnvolle einer Waffe wie der Smith & Wesson ist ihr eingetragener Markenname. Damit lässt sich jede Menge Kohle machen, wenn man es klug angeht.
Das einzig Sinnvolle einer Waffe wie der Smith & Wesson ist ihr eingetragener Markenname. Damit lässt sich jede Menge Kohle machen, wenn man es klug angeht.
Alessandro Baricco formt aus dem Waffenmythos ein groteskes Medienstück, dessen Botschaft lautet, gute Geschäfte gehen immer mit der Todessehnsucht des Publikums einher. Das Stück selbst ist in Akte und Sätze eingeteilt wie eine Oper oder ein Kammerstück, die Figuren, einmal in Szene gesetzt, reden wie Wladimir und Estragon im Warten auf Godot, und als Bühnenbild gewaltigen Ausmaßes dienen die Niagarafälle, weil es dort die meisten Suizide und Hochzeitsreisen des Kontinents gibt.

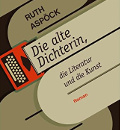 Einer Dichterin verzeiht man in unserer ewig jungen Konsumkultur vielleicht noch am ehesten, dass sie alt wird. Die Leserschaft erwartet sich von ihr eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem Literaturbetrieb und Geschichten, die von Lebenserfahrung gespeist sind.
Einer Dichterin verzeiht man in unserer ewig jungen Konsumkultur vielleicht noch am ehesten, dass sie alt wird. Die Leserschaft erwartet sich von ihr eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem Literaturbetrieb und Geschichten, die von Lebenserfahrung gespeist sind.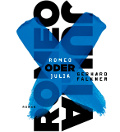 Im postmodernen Literaturbetrieb steckt ähnlich einer russischen Puppe immer eine Inszenierung in der anderen. Mal ist es ein Buch, dann ein Festival, dann eine biographische Begebenheit, dann ein Traum, dann eine Love-Story aus der Erinnerung. Alle sind nach einem positiven Strickmuster geformt, damit sie auf den Klappentext passen.
Im postmodernen Literaturbetrieb steckt ähnlich einer russischen Puppe immer eine Inszenierung in der anderen. Mal ist es ein Buch, dann ein Festival, dann eine biographische Begebenheit, dann ein Traum, dann eine Love-Story aus der Erinnerung. Alle sind nach einem positiven Strickmuster geformt, damit sie auf den Klappentext passen.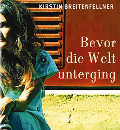 Eine Historiker-Weisheit sagt, dass man für sein eigenes historisches Bewusstsein mindestens 30 Jahre alt sein muss. Davor ist alles ahistorisch und einmalig, erst später kann man sein eigenes Leben in Zusammenhänge fassen und an die Zeitgeschichte andocken.
Eine Historiker-Weisheit sagt, dass man für sein eigenes historisches Bewusstsein mindestens 30 Jahre alt sein muss. Davor ist alles ahistorisch und einmalig, erst später kann man sein eigenes Leben in Zusammenhänge fassen und an die Zeitgeschichte andocken. Gute Sprichwörter erleichtern zwar den Tagesablauf zwischendurch, harte Sachen freilich müssen in der Literatur die Helden umso heftiger ausbaden, je bessere Sprichwörter sie kennen.
Gute Sprichwörter erleichtern zwar den Tagesablauf zwischendurch, harte Sachen freilich müssen in der Literatur die Helden umso heftiger ausbaden, je bessere Sprichwörter sie kennen. Als die scheinbar ewigste Stadt der Welt besteht Rom einerseits aus lauter Kleinodien triefend vor Geschichte, andererseits aus brutalster Schwarzweiß-Szenerie wie in einer vom Staat aufgegebenen mexikanischen Stadt.
Als die scheinbar ewigste Stadt der Welt besteht Rom einerseits aus lauter Kleinodien triefend vor Geschichte, andererseits aus brutalster Schwarzweiß-Szenerie wie in einer vom Staat aufgegebenen mexikanischen Stadt. Bevor die Chose mit dem echten Leben losgeht, gibt es für die Helden meist noch einen Erlebnisrausch, worin Ort, Zeit und Ziel völlig egal sind.
Bevor die Chose mit dem echten Leben losgeht, gibt es für die Helden meist noch einen Erlebnisrausch, worin Ort, Zeit und Ziel völlig egal sind. Seit die Menschen Tag und Nacht online sind, heißt die häufigste Formel der Begegnung: Können wir den Termin verschieben? Dahinter steckt die Ahnung, dass man die Zeit nur besiegen kann, wenn man sie verschiebt.
Seit die Menschen Tag und Nacht online sind, heißt die häufigste Formel der Begegnung: Können wir den Termin verschieben? Dahinter steckt die Ahnung, dass man die Zeit nur besiegen kann, wenn man sie verschiebt.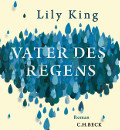 Wenn es nach den Forschungsdisziplinen Psychologie und Literatur geht, sind Vater und Tochter ausschließlich deshalb auf der Welt, damit sie Schwierigkeiten kriegen und dann einen Psychologen oder eine Bibliothek aufsuchen können.
Wenn es nach den Forschungsdisziplinen Psychologie und Literatur geht, sind Vater und Tochter ausschließlich deshalb auf der Welt, damit sie Schwierigkeiten kriegen und dann einen Psychologen oder eine Bibliothek aufsuchen können.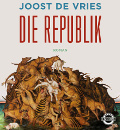 Das ganze Hotel voller Hitler-Experten, am Gang sieht man den niederländischen Rechten-Führer vorbeihuschen, in der Seitengasse werden in einem Antiquitätenladen originale Hitler-Devotionalien angeboten, am Heldenplatz imaginieren die Hitler-Forscher den Führer auf den Balkon – Wien ist für ein paar Tage der Austragungsort eines Welt-Hitler-Kongresses.
Das ganze Hotel voller Hitler-Experten, am Gang sieht man den niederländischen Rechten-Führer vorbeihuschen, in der Seitengasse werden in einem Antiquitätenladen originale Hitler-Devotionalien angeboten, am Heldenplatz imaginieren die Hitler-Forscher den Führer auf den Balkon – Wien ist für ein paar Tage der Austragungsort eines Welt-Hitler-Kongresses.