Reinhard Kleindl, Baumgartner und die Brandstifter
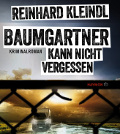 Wenn die Sinnesorgane auf Verbrechen eingestellt sind, entdecken sie überall und in den idyllischsten Lagen jenen Rauch, der bei Verbrechen gerne aufsteigt.
Wenn die Sinnesorgane auf Verbrechen eingestellt sind, entdecken sie überall und in den idyllischsten Lagen jenen Rauch, der bei Verbrechen gerne aufsteigt.
Reinhard Kleindl ist mit seinem Krimi-Helden Baumgartner literarisch raffiniert unterwegs. Dadurch, dass Baumgarnter wie alle österreichischen Beamten vom Hocken sehr müde und derangiert ist, braucht er nur die halbe Zeit im Einsatz zu sein. Auch im neuen Krimi kommt er erst in der zweiten Ermittlungshalbzeit zu seinem Auftritt, völlig von Tabletten niedergerungen und auch sonst nur bei losem Verstand.

 Schatten und Strand sind bei kluger Anwendung schöne Metaphern für das Bewegliche, Un-Fixe, Veränderbare. Beim Strandschatten tauchen in der Vorstellung vielleicht dunkle Flecken auf, die sich im Sonnenlicht um einen Erzählstandpunkt herum bewegen.
Schatten und Strand sind bei kluger Anwendung schöne Metaphern für das Bewegliche, Un-Fixe, Veränderbare. Beim Strandschatten tauchen in der Vorstellung vielleicht dunkle Flecken auf, die sich im Sonnenlicht um einen Erzählstandpunkt herum bewegen.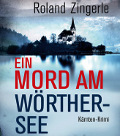 Gegenden, die von Menschen mit gedämpftem Selbstbewusstsein bewohnt werden, tragen gerne verrückte Sportarten aus. So wird der grenzwertige Macho-Dolomiten-Mann naturgemäß in Osttirol ermittelt, während der Kärntner Ironman am Wörthersee sich durch deftiges Kraulen und Strampeln hervortut.
Gegenden, die von Menschen mit gedämpftem Selbstbewusstsein bewohnt werden, tragen gerne verrückte Sportarten aus. So wird der grenzwertige Macho-Dolomiten-Mann naturgemäß in Osttirol ermittelt, während der Kärntner Ironman am Wörthersee sich durch deftiges Kraulen und Strampeln hervortut. In diversen Heldenbiographien inklusive jener von Andreas Hofer wird immer zu wenig die Kugel gewürdigt, die aus einem normalen Menschen einen Helden macht.
In diversen Heldenbiographien inklusive jener von Andreas Hofer wird immer zu wenig die Kugel gewürdigt, die aus einem normalen Menschen einen Helden macht. Was passiert eigentlich, wenn jemand, der das Verschwinden von Personen und Dingen bemerkt, selbst verschwindet?
Was passiert eigentlich, wenn jemand, der das Verschwinden von Personen und Dingen bemerkt, selbst verschwindet?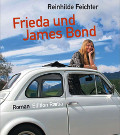 Bildung entsteht letztlich dadurch, dass man sich als Individuum eine persönliche App in seine Psyche herunterlädt, die einem immer erklärt, was man zu tun hat.
Bildung entsteht letztlich dadurch, dass man sich als Individuum eine persönliche App in seine Psyche herunterlädt, die einem immer erklärt, was man zu tun hat. 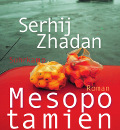 Ein gelungenes Cover vermag sinnlich auf das Kernthema eines Buches hinzuweisen. Wenn selbst der Titel „Mesopo / tamien“ in zwei Teile zerlegt ist, vermag man sich schon auszumalen, welche Zerrissenheit einen in diesem Zweistromland erwarten wird.
Ein gelungenes Cover vermag sinnlich auf das Kernthema eines Buches hinzuweisen. Wenn selbst der Titel „Mesopo / tamien“ in zwei Teile zerlegt ist, vermag man sich schon auszumalen, welche Zerrissenheit einen in diesem Zweistromland erwarten wird. Zukunftsprognosen werden meist von jener Stimmung getragen, die gerade in der Gegenwart als virulent empfunden werden. Prognostische Romane sagen also immer etwas über die Gegenwart aus.
Zukunftsprognosen werden meist von jener Stimmung getragen, die gerade in der Gegenwart als virulent empfunden werden. Prognostische Romane sagen also immer etwas über die Gegenwart aus.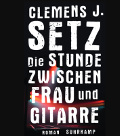 Kluge Titel evozieren die ganze Welt durch einen idealen Sehschlitz. Die Stunde zwischen Frau und Gitarre ist vielleicht ein Stillleben, das zu einem Wimmelbild ausgeufert ist.
Kluge Titel evozieren die ganze Welt durch einen idealen Sehschlitz. Die Stunde zwischen Frau und Gitarre ist vielleicht ein Stillleben, das zu einem Wimmelbild ausgeufert ist.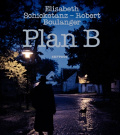 Das Digitale kämpft gegen das Animalische und ist vielleicht identisch damit! Wer einmal ein File um diesen Kampf hat verschicken wollen, kennt das Gefühl, plötzlich am Präsentierteller eines Geheimdienstes zu liegen.
Das Digitale kämpft gegen das Animalische und ist vielleicht identisch damit! Wer einmal ein File um diesen Kampf hat verschicken wollen, kennt das Gefühl, plötzlich am Präsentierteller eines Geheimdienstes zu liegen.