Piketty, Thomas. Die Schlacht um den Euro
 „Einige Texte haben inzwischen etwas Patina angesetzt, andere sind noch aktuell. Sie zeugen sämtlich vom Versuch eines Sozialwissenschaftlers, das Tagesgeschehen zu analysieren, sich in die öffentliche Auseinandersetzung einzumischen und die Verantwortung des Forschers mit der des Bürgers in Einklang zu bringen.“ (9)
„Einige Texte haben inzwischen etwas Patina angesetzt, andere sind noch aktuell. Sie zeugen sämtlich vom Versuch eines Sozialwissenschaftlers, das Tagesgeschehen zu analysieren, sich in die öffentliche Auseinandersetzung einzumischen und die Verantwortung des Forschers mit der des Bürgers in Einklang zu bringen.“ (9)
Unterteilt in drei große Kapitel bietet das Buch eine Zusammenstellung von Beiträgen, die der Autor in der französischen Zeitung Libération in der Zeit zwischen 2008 bis 2015 veröffentlicht hat. Sie bieten anhand von zahlreichen Artikel zu tagesaktuellen Themen einen Rückblick und einen Ausblick auf die Lage der Weltwirtschaft sowie auf die aktuelle Krise innerhalb der Europäischen Union.

 „Das vorliegende Werk will in zwei Bänden einem weit verbreiteten Mangel abhelfen. Gemeint ist die fehlende oder nur unvollkommen entfaltete Fähigkeit vieler Menschen, sich gegenüber anderen Personen oder gar in der Öffentlichkeit politisch zu artikulieren.“ (9)
„Das vorliegende Werk will in zwei Bänden einem weit verbreiteten Mangel abhelfen. Gemeint ist die fehlende oder nur unvollkommen entfaltete Fähigkeit vieler Menschen, sich gegenüber anderen Personen oder gar in der Öffentlichkeit politisch zu artikulieren.“ (9) „Man muss es immer wieder sagen: Der Schlüssel zur Lösung der Eurokrise liegt in der Hand Deutschlands und nicht in den Händen der kleinen Länder, die verzweifelt versuchen die Auflagen der Troika zu halten, und doch niemals erfolgreich sein können.“ (55)
„Man muss es immer wieder sagen: Der Schlüssel zur Lösung der Eurokrise liegt in der Hand Deutschlands und nicht in den Händen der kleinen Länder, die verzweifelt versuchen die Auflagen der Troika zu halten, und doch niemals erfolgreich sein können.“ (55)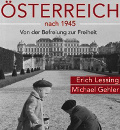 „Dieses Werk beginnt mit einem etwas unkonventionellen vierfachen Einstieg. Die Fragen, die uns bei der Erstellung der Bilddokumentation bewegten, lauteten: Was steht für das alte, was für das wiedererstandene, was für das neue und was in gewisser Weise immer noch für das heutige Österreich?“ (7)
„Dieses Werk beginnt mit einem etwas unkonventionellen vierfachen Einstieg. Die Fragen, die uns bei der Erstellung der Bilddokumentation bewegten, lauteten: Was steht für das alte, was für das wiedererstandene, was für das neue und was in gewisser Weise immer noch für das heutige Österreich?“ (7) Jedes Buch löst in der Leserschaft Reaktionen aus, aber darüber hinaus ergibt sich auch ein Wechselspiel zwischen Leseambiente und Lektüre. Ein Buch über das Sterben wirkt in einem Umfeld voller Apps wischender Kids und in Krimis blätternden Bobos geradezu elementar herausragend.
Jedes Buch löst in der Leserschaft Reaktionen aus, aber darüber hinaus ergibt sich auch ein Wechselspiel zwischen Leseambiente und Lektüre. Ein Buch über das Sterben wirkt in einem Umfeld voller Apps wischender Kids und in Krimis blätternden Bobos geradezu elementar herausragend.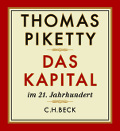 „Dennoch glaube ich, dass Forscher aus den Sozialwissenschaften wie allen anderen Disziplinen, Journalisten und Kommentatoren sämtlicher Medien, Gewerkschaftler und politische Aktivisten aller Richtungen, und vor allem sämtliche Bürger ernsthaft über Geld nachdenken sollten […]. Diejenigen, die viel davon haben, werden gewiss nicht vergessen, ihre Interessen zu verteidigen. Von den Zahlen nichts wissen zu wollen, dient selten der Sache der Ärmsten.“ (793)
„Dennoch glaube ich, dass Forscher aus den Sozialwissenschaften wie allen anderen Disziplinen, Journalisten und Kommentatoren sämtlicher Medien, Gewerkschaftler und politische Aktivisten aller Richtungen, und vor allem sämtliche Bürger ernsthaft über Geld nachdenken sollten […]. Diejenigen, die viel davon haben, werden gewiss nicht vergessen, ihre Interessen zu verteidigen. Von den Zahlen nichts wissen zu wollen, dient selten der Sache der Ärmsten.“ (793)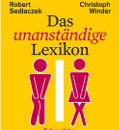 Wenn es Richtung Tabu geht, benimmt sich die Sprache wie ein aufgeregtes Kind. Nirgendwo ist sie so neugierig, witzig und erfinderisch wie in Szenen, wo es darum geht, spritzige Fügungen über Ausscheidungen, verhüllte Organe und Geschlechtsverkehre zu kreieren.
Wenn es Richtung Tabu geht, benimmt sich die Sprache wie ein aufgeregtes Kind. Nirgendwo ist sie so neugierig, witzig und erfinderisch wie in Szenen, wo es darum geht, spritzige Fügungen über Ausscheidungen, verhüllte Organe und Geschlechtsverkehre zu kreieren.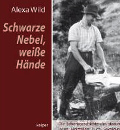 Die Geschichte ist insgesamt ein grobmaschiges System, durch das letztlich mehr Menschen unbehelligt bleiben als von ihr wahrgenommen werden. Vielleicht ist es der geheime Sinn von Menschen in Randlage, dass sie ihre Geschichte individuell verwalten und sie nicht als Baustein irgendeines Gefüges ausgenutzt werden.
Die Geschichte ist insgesamt ein grobmaschiges System, durch das letztlich mehr Menschen unbehelligt bleiben als von ihr wahrgenommen werden. Vielleicht ist es der geheime Sinn von Menschen in Randlage, dass sie ihre Geschichte individuell verwalten und sie nicht als Baustein irgendeines Gefüges ausgenutzt werden.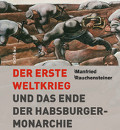 „Österreich-Ungarn aber, eine – wie es so schön hieß – »stagnierende Großmacht«, sah ähnlich wie Großbritannien in der Aufrechterhaltung der geltenden europäischen Ordnung eine Chance. Das aber nicht aus innerster Überzeugung, sondern aufgrund einer evidenten Schwäche. Sie, und vor allem sie war der Grund dafür, dass Krieg zur Lösung der Probleme dann doch wenn schon nicht angestrebt, so nicht mehr regelrecht ausgeschlossen wurde.“ (14)
„Österreich-Ungarn aber, eine – wie es so schön hieß – »stagnierende Großmacht«, sah ähnlich wie Großbritannien in der Aufrechterhaltung der geltenden europäischen Ordnung eine Chance. Das aber nicht aus innerster Überzeugung, sondern aufgrund einer evidenten Schwäche. Sie, und vor allem sie war der Grund dafür, dass Krieg zur Lösung der Probleme dann doch wenn schon nicht angestrebt, so nicht mehr regelrecht ausgeschlossen wurde.“ (14) Das Druckwesen hat zur Entwicklung der Gesellschaft mindestens so viel beigetragen wie die Adelsgeschlechter zusammen, daher gebührt es einer guten Druckerei, dass sie zwischendurch epochal dargestellt wird.
Das Druckwesen hat zur Entwicklung der Gesellschaft mindestens so viel beigetragen wie die Adelsgeschlechter zusammen, daher gebührt es einer guten Druckerei, dass sie zwischendurch epochal dargestellt wird.