Martin Kolozs, Sommer ohne Sonne
 Als Katastrophe gilt im Tourismus generell jedes Phänomen, wonach die Jahreszeiten aus dem gewohnten Bild ausbüchsen. Winter ohne Schnee, Herbst ohne Blätter, Frühjahr ohne Blüten gelten als Desaster.
Als Katastrophe gilt im Tourismus generell jedes Phänomen, wonach die Jahreszeiten aus dem gewohnten Bild ausbüchsen. Winter ohne Schnee, Herbst ohne Blätter, Frühjahr ohne Blüten gelten als Desaster.
Martin Kolozs nimmt diese negativen Idealbilder zum Anlass, um darin eine Künstler-Karriere zu installieren. Sommer ohne Sonne zeigt einen Mann, der am Höhepunkt seiner Liebes- und Genitalfähigkeit ohne Sonne einem diffusen Horizont entgegen dämmert.

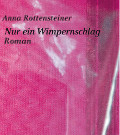 Die Literatur schafft die Möglichkeit, die Zeit so zu verdichten, dass sie in einem Wimpernschlag untergebracht werden kann. Diese Verdichtung lässt sich auf ein ganzes Leben ausdehnen, so dass in quasi in einem Standbild der Erinnerung alles aufgezeichnet ist.
Die Literatur schafft die Möglichkeit, die Zeit so zu verdichten, dass sie in einem Wimpernschlag untergebracht werden kann. Diese Verdichtung lässt sich auf ein ganzes Leben ausdehnen, so dass in quasi in einem Standbild der Erinnerung alles aufgezeichnet ist. Eine besonders professionelle Form einer Roman-Struktur besteht im Nacherzählen, Umschreiben und persönlichen Infiltrieren eines anerkannten Textes. 1962 ist der Roman „Die Gärten der Finzi Contini“ von Giorgio Bassani erschienen, 1975 kommt die Verfilmung durch Vittorio De Sica.
Eine besonders professionelle Form einer Roman-Struktur besteht im Nacherzählen, Umschreiben und persönlichen Infiltrieren eines anerkannten Textes. 1962 ist der Roman „Die Gärten der Finzi Contini“ von Giorgio Bassani erschienen, 1975 kommt die Verfilmung durch Vittorio De Sica. Viele Kriminalfälle entstehen ja dadurch, dass die Wortwahl oft völlig divergierende Deutungen eines Sachverhaltes zulässt. Machtblind kann heißen, dass jemand wegen seiner Macht blind wird, oder aber, dass jemand gegenüber der Macht blind wird.
Viele Kriminalfälle entstehen ja dadurch, dass die Wortwahl oft völlig divergierende Deutungen eines Sachverhaltes zulässt. Machtblind kann heißen, dass jemand wegen seiner Macht blind wird, oder aber, dass jemand gegenüber der Macht blind wird.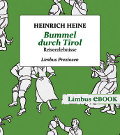 Wenn eine Berühmtheit etwas sagt, können auch sogenannte blöde Sätze äußerst wertvoll werden. Der Sager „Innsbruck selbst ist eine unwohnliche, blöde Stadt“ wird zwar für richtig gehalten und tausendmal am Tag ausgesprochen, aber erst dass dieser Satz von Heinrich Heine stammt, macht ihn so wertvoll.
Wenn eine Berühmtheit etwas sagt, können auch sogenannte blöde Sätze äußerst wertvoll werden. Der Sager „Innsbruck selbst ist eine unwohnliche, blöde Stadt“ wird zwar für richtig gehalten und tausendmal am Tag ausgesprochen, aber erst dass dieser Satz von Heinrich Heine stammt, macht ihn so wertvoll.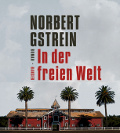 In den guten multiplen Romanen gibt es so viele Lesemöglichkeiten, dass zwei Leser im Gespräch darüber oft eine Zeitlang brauchen, um zu kapieren, dass sie den gleichen Roman gelesen haben.
In den guten multiplen Romanen gibt es so viele Lesemöglichkeiten, dass zwei Leser im Gespräch darüber oft eine Zeitlang brauchen, um zu kapieren, dass sie den gleichen Roman gelesen haben.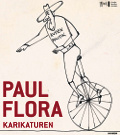 Das Publikum sieht oft etwas ganz Anderes in den Bildern, als es der Urheber vielleicht gedacht hat. So sagen die Tiroler jedenfalls zu allem, was wie eine Federzeichnung ausschaut, Karikatur, weil sie die Welt meist als Federzeichnung empfinden.
Das Publikum sieht oft etwas ganz Anderes in den Bildern, als es der Urheber vielleicht gedacht hat. So sagen die Tiroler jedenfalls zu allem, was wie eine Federzeichnung ausschaut, Karikatur, weil sie die Welt meist als Federzeichnung empfinden. Wenn man einem Außerirdischen die gebräuchlichste Form der Kommunikation erklären wollte, müsste man zuerst das Gesprächsgegoogle erklären. Jemand beginnt einen Satz, weiß aber nicht, was das nächste Wort bedeutet, googelt es, und setzt dann mit dem Satz fort. Ähnlich reagieren manche Zeitgenossen, die besonders mundartlich unterwegs sind, sie beginnen den Satz, schlagen im Taschenmundartbuch nach, wie das nächste Wort am besten klingt, und sprechen es dann aus.
Wenn man einem Außerirdischen die gebräuchlichste Form der Kommunikation erklären wollte, müsste man zuerst das Gesprächsgegoogle erklären. Jemand beginnt einen Satz, weiß aber nicht, was das nächste Wort bedeutet, googelt es, und setzt dann mit dem Satz fort. Ähnlich reagieren manche Zeitgenossen, die besonders mundartlich unterwegs sind, sie beginnen den Satz, schlagen im Taschenmundartbuch nach, wie das nächste Wort am besten klingt, und sprechen es dann aus. Manchmal erzählt ein winziger Druckfehler eine ganze Geschichte der Hoffnung und Unsterblichkeit. Im Abschlusskommentar zum dritten Band „Das Gedächtnis der Wellen“ von Gerhard Kofler wird sein letztes Gedicht auf 24. August 2015 datiert, ein logischer Gedanke, denn niemand kann es noch glauben, dass der Autor 2005 gestorben ist.
Manchmal erzählt ein winziger Druckfehler eine ganze Geschichte der Hoffnung und Unsterblichkeit. Im Abschlusskommentar zum dritten Band „Das Gedächtnis der Wellen“ von Gerhard Kofler wird sein letztes Gedicht auf 24. August 2015 datiert, ein logischer Gedanke, denn niemand kann es noch glauben, dass der Autor 2005 gestorben ist. Hinter jedem gelungenen Buch steckt eine vollkommene Bibliothek. Manchmal bedanken sich Autorinnen und Autoren bei diesen Bibliotheken, andere setzen auf den Genie-Begriff und behaupten, sich alles selbst aus den Hirnwindungen gesogen zu haben.
Hinter jedem gelungenen Buch steckt eine vollkommene Bibliothek. Manchmal bedanken sich Autorinnen und Autoren bei diesen Bibliotheken, andere setzen auf den Genie-Begriff und behaupten, sich alles selbst aus den Hirnwindungen gesogen zu haben.