Martin Maier, Geht auch anders
 Die meisten Weisheiten zum Alltag sind so unauffällig formuliert, dass man sich zwar an sie hält, aber kaum als Literatur oder Lebenskunst wahrnimmt.
Die meisten Weisheiten zum Alltag sind so unauffällig formuliert, dass man sich zwar an sie hält, aber kaum als Literatur oder Lebenskunst wahrnimmt.
Martin Maier geht in seinem Alltags-Vademecum „Geht auch anders“ diesen scheinbar über-vernünftigen lapidaren Erkenntnissen mit einem grotesken Lebensbüchlein nach. Darin formuliert ein „Held ohne Eigenschaften“ in einer Art öffentlichem Selbstgespräch bemerkenswerte Einschätzungen zu jener Lage, in die ein Durchschnittsmensch täglich versetzt wird, sobald er nachzudenken anfängt.

 Was geschieht mit all den Nachrichten, die ununterbrochen aus dem Netz, TV und aus Zeitungen fallen? – Sie kondensieren zu Junihitze, die über ein Kippfenster zwischen dumpfer Wohnung und dampfender Terrasse hin und her schwebt. Sie macht den Helden schlaflos und schwindlig.
Was geschieht mit all den Nachrichten, die ununterbrochen aus dem Netz, TV und aus Zeitungen fallen? – Sie kondensieren zu Junihitze, die über ein Kippfenster zwischen dumpfer Wohnung und dampfender Terrasse hin und her schwebt. Sie macht den Helden schlaflos und schwindlig. Was arbeitest du? - Ich arbeite jedes Jahr für Weihnachten. Gemessen an diesem häufig geäußerten Kerndialog über Weihnachten arbeiten so gut wie alle Berufsgruppen an diesem „unbeweglichen Fest“, das als fixe Höhenkote für die Vermessung des Jahres gilt.
Was arbeitest du? - Ich arbeite jedes Jahr für Weihnachten. Gemessen an diesem häufig geäußerten Kerndialog über Weihnachten arbeiten so gut wie alle Berufsgruppen an diesem „unbeweglichen Fest“, das als fixe Höhenkote für die Vermessung des Jahres gilt. In der Bezirksstadt Gmünd klettert am Friedhof ein Nackter auf das Dach des Mausoleums und wartet auf seine Abführung. Die freiwillige Feuerwehr breitet zur Vorsicht das Sprungtuch aus, aber der Held lässt sich manuell retten und wird nach Wien in die Psychiatrie gebracht, wo alsbald die Diagnose fällt: „Der Nackte am Friedhof war irr.“ (23)
In der Bezirksstadt Gmünd klettert am Friedhof ein Nackter auf das Dach des Mausoleums und wartet auf seine Abführung. Die freiwillige Feuerwehr breitet zur Vorsicht das Sprungtuch aus, aber der Held lässt sich manuell retten und wird nach Wien in die Psychiatrie gebracht, wo alsbald die Diagnose fällt: „Der Nackte am Friedhof war irr.“ (23)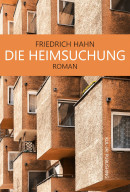 Wer im literarischen Kosmos des Friedrich Hahn Heldin oder Held sein will, muss sich die Qualität eines Sandkorns im Stundenglas zulegen. Der mehrdeutige Begriff „Heimsuchung“ stellt sich im höheren Alter oft in den Weg einer glatten Biographie. Einerseits ist darunter eine soziale Einrichtung zu verstehen, worin Pflege und Obsorge als kleines Paradies angeboten werden, andererseits lässt sich eine amorphe Lebenssituation durchaus als pure Bedrohung deuten. „Ist die Suche nach dem Heim abgeschlossen, beginnt die Heimsuchung.“
Wer im literarischen Kosmos des Friedrich Hahn Heldin oder Held sein will, muss sich die Qualität eines Sandkorns im Stundenglas zulegen. Der mehrdeutige Begriff „Heimsuchung“ stellt sich im höheren Alter oft in den Weg einer glatten Biographie. Einerseits ist darunter eine soziale Einrichtung zu verstehen, worin Pflege und Obsorge als kleines Paradies angeboten werden, andererseits lässt sich eine amorphe Lebenssituation durchaus als pure Bedrohung deuten. „Ist die Suche nach dem Heim abgeschlossen, beginnt die Heimsuchung.“ Die ideale Shortstory ist ein fiktionaler Kitt zwischen zwei scheinbar realen Situationen. Sie kann folglich jederzeit an jedem Ort auftreten und verändert ihr Erscheinungsbild zusammen mit dem Plot, den sie vorgibt zu erzählen.
Die ideale Shortstory ist ein fiktionaler Kitt zwischen zwei scheinbar realen Situationen. Sie kann folglich jederzeit an jedem Ort auftreten und verändert ihr Erscheinungsbild zusammen mit dem Plot, den sie vorgibt zu erzählen.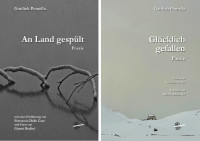 Meist sind es die Antriebskräfte Aufbruch und Ausklang, die Menschen Gedichte formen lassen, um für sich etwas Klarheit zu schaffen über die seltsamen Vorgänge rund ums Leben.
Meist sind es die Antriebskräfte Aufbruch und Ausklang, die Menschen Gedichte formen lassen, um für sich etwas Klarheit zu schaffen über die seltsamen Vorgänge rund ums Leben. Stille ist in der Literatur ein magischer Raum, der das Ich umschließt, ohne es zu bedrücken. Im Gegenteil, Stille fordert die Reduktion auf das momentan Wesentliche geradezu heraus. Die Dauer dieses Zustands kann ein paar Tage dauern wie bei der „Stillen Zeit“ um Weihnachten herum, oder einer ganzen Epoche den Stempel aufdrücken, wie in Henry Millers Roman „Stille Tage in Clichy“.
Stille ist in der Literatur ein magischer Raum, der das Ich umschließt, ohne es zu bedrücken. Im Gegenteil, Stille fordert die Reduktion auf das momentan Wesentliche geradezu heraus. Die Dauer dieses Zustands kann ein paar Tage dauern wie bei der „Stillen Zeit“ um Weihnachten herum, oder einer ganzen Epoche den Stempel aufdrücken, wie in Henry Millers Roman „Stille Tage in Clichy“.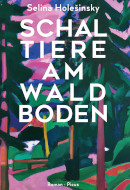 Ein Dorf ist in der Fiktion ein gern gesehener Ort, um darin Idylle, Schrecken, Wokeness oder Klimaschutz in Szene zu setzen. Mit Wimmelbildern der Kindheit wird dieser Ort gerne als analoge Wunderwelt dargestellt, worin sich die erwachsen gewordenen Kinder später einmal zurückziehen werden. Die Wirklichkeit ist freilich auch in Romanen alles andere als eine heile Welt.
Ein Dorf ist in der Fiktion ein gern gesehener Ort, um darin Idylle, Schrecken, Wokeness oder Klimaschutz in Szene zu setzen. Mit Wimmelbildern der Kindheit wird dieser Ort gerne als analoge Wunderwelt dargestellt, worin sich die erwachsen gewordenen Kinder später einmal zurückziehen werden. Die Wirklichkeit ist freilich auch in Romanen alles andere als eine heile Welt.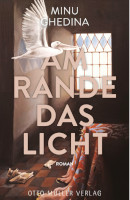 Kunst kann zur Erbkrankheit werden, wenn man als Kind im Licht großer Künstlereltern aufwachsen muss. Minu Ghedina spielt im Künstlerroman „Am Rande das Licht“ mit dem Wechselspiel von eigener Entwicklung und allgemeinem Anspruch in der Gesellschaft. Wie lässt sich der Rand eines Bildes ausleuchten, ohne dass das Auge vom Bannstrahl der mediokren Mitte verbrannt wird?
Kunst kann zur Erbkrankheit werden, wenn man als Kind im Licht großer Künstlereltern aufwachsen muss. Minu Ghedina spielt im Künstlerroman „Am Rande das Licht“ mit dem Wechselspiel von eigener Entwicklung und allgemeinem Anspruch in der Gesellschaft. Wie lässt sich der Rand eines Bildes ausleuchten, ohne dass das Auge vom Bannstrahl der mediokren Mitte verbrannt wird?