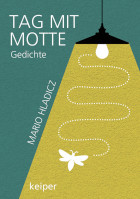 Gedichte sind unter anderem dazu da, die Zeit anzuhalten und die darin aufgestapelten Vorgänge einzumotten. Gedichte sind die idealen Mottenkugeln, heißt es in einer gängigen Anleitung für Alltagslyrik.
Gedichte sind unter anderem dazu da, die Zeit anzuhalten und die darin aufgestapelten Vorgänge einzumotten. Gedichte sind die idealen Mottenkugeln, heißt es in einer gängigen Anleitung für Alltagslyrik.
Mario Hladicz greift diese Theorie auf, und überschreibt seine Gedichte mit „Tag mit Motte“. Darin ist subsumiert, dass in den Gedichten der Ablauf der Zeit angehalten und für die Konservierung tauglich gemacht wird. Dass dann die Gedichte wie Motten unerwartet aus dem Depot fliegen, ist beabsichtigter Kollateralschaden.
„Tag mit Motte // Es ist nämlich so erst passiert wenig bis / nichts so bis um sieben halb acht dann / flattert sie an mir vorbei und malt mit / jedem Flügelschlag das Fenster aus mit / Licht das macht das Aufstehen erträglich“ (50)
In diesem Titelgedicht ist der Gedichtband als Minikosmos verpresst und in geblockten Strophen abgelegt. Das lyrische Ich geht vom Standby der Nacht allmählich in den Beobachtungsmodus über, die Systeme werden hochgefahren, als tägliches Update fliegt eine Motte vorbei und zeigt im Flug diverse graphische Strukturen, ehe sie dann am Bildschirm, hier noch als altbewährtes Fenster ausgeführt, das Licht dämmt, um dem lyrischen Ich das Aufstehen zu erleichtern.
Der alltägliche Vorgang des Aufstehens wird zu einem zeitlosen Ereignis verfestigt, das mustergültig für die tausend anderen Erweckungsvorgänge steht, die ein lyrisches Ich zu absolvieren hat. Die Doppeldeutigkeit als analoge Tierwelt und digitale Bildschirmrealität schwingt in vielen Texten mit, wie ja auch das Lesen längst ein Wechselspiel zwischen digitaler und virtueller (Traum-) Welt geworden ist.
Im Schlussgedicht poppt diese Ambivalenz noch einmal mustergültig auf, indem eine Maus zuerst im Traum und dann als tote Maus im PC-Betrieb erscheint.
Traum // Ich war eine tote Maus abgelegt / neben dem Bett […] (86)
Die Gedichtsammlung ist in drei Kapitel unterteilt, die ähnlich einer Flugbewegung die Abschnitte Aufstieg, Gleitflug, Landung symbolisieren. Das Layout ist diskret unauffällig gehalten, indem die einzelnen Blöcke suggerieren, es handle sich um konventionelle Lyrik aus vergangener Zeit. In Wirklichkeit sind diese Text-Zusammenballungen an die Ästhetik von Smart-Displays angeglichen, jede Strophe ist zur Gänze zu sehen und wird dann weggewischt und durch einen neue ersetzt.
Am Beispiel des Friedhofspaziergangs (42) wird eine Art geographische App dem Wandeln zwischen den Grabsteinen zugrunde gelegt, die abgelegten Verstorbenen und deren Inschriften sind ähnlich ausgearbeitet, wie man in verfallenen Schlössern manchmal einen modernen digitalen Guide installiert, damit die Betrachter zuerst auf die digitale Vorinformation schauen und nicht vom jähen Anblick der ungefilterten Realität getriggert werden.
Im „Aufstiegsflug“ der Gedichte ist vom Morgen die Rede, wenn die Tage angeworfen werden, eine Ente schleicht sich ins Bild, um darauf hinzuweisen, dass Vögel auch bodenständig sein können, ein Buchhändler spannt einen Bogen über die Krankenhauskantine hin zu einem Text vom vom Alleinsein ( 28): „macht den Morgen verhangen als würde eine / einsame Frau sehr langsam und in der / kleiner werdenden Hoffnung jemand / tauche doch noch in der Hofeinfahrt auf“.
Im mittleren Kapitel wird angelesenes und ausgerolltes Inventar des Lyrikhandwerks zum Einsatz gebracht, ein Bibliothekar berichtet von den Schätzen, „was ich in Büchern fand“. (35) Lesende nämlich hinterlegen Botschaften in den Büchern, wenn sie diese in der Bibliothek in die Klappe für verlorene Kinder werfen. Am Dach sitzen derweil die obligaten Vögel, die in jedem Gedichtband vorkommen müssen um kundzutun, dass sie bald ausgestorben sein werden wie ihre Vorfahren, die Dinos.
Sprichwort-artig räumt eine Witwe ihren Mann auf, indem sie feststellt, dass sie jetzt auf der Couch Platz habe, weil er nur noch als schmales Gedenkbild im Regal stehe. Wenn die Gedichte die Herrschaft über eine Gegend übernommen haben, wird aus dem Wilden Westen ein milder, wenn nicht gar die Welt zu einem Stillleben verkommt, das die Nachtschicht erwartet.
Der Abgesang des Tages beginnt mit einem Protokoll, das ein kollektives Wir verfasst: „Der Tag brütet den ganzen Tag über / uns es hat ja doch keinen Sinn sich / dagegen zu sträuben“ (65) Zwischen den Zeilen scheint sich jäh ein neuer Sinn aufzutun, aber schon in der übernächsten Zeile fällt alles wieder wie gehabt in Routine zurück, währen der der Tag sogar am Tisch herum lümmelt.
Allmählich strebt alles dem Ende entgegen, der November deutet an, dass vieles vergänglich unter Laub verschwinden wird, spät taucht noch ein Gast auf und es stellt sich heraus, dass es der Alltag ist, der noch vorbeischaut. Beckett und die Katze ringen derweil um die Deutungshoheit über den Begriff: Texte um Nichts.
Und dann ist das Ende zum Greifen nah. „Ein letztes Mal raus in den Nebel / die Pferde füttern mit altem Brot / der Hund bleibt liegen beim Ofen / womöglich für immer später Oktober / und der Dachboden knackt bedenklich / aber behält sein Geheimnis für sich“ (84)
Was für ein Tag mit Motte! Auf jede Nuance kommt es drauf an.
Mario Hladicz, Tag mit Motte. Gedichte
Graz: edition keiper 2023, 90 Seiten, 20,00 €, ISBN 978-3-903322-88-2
Weiterführender Link:
Edition Keiper: Mario Hladicz, Tag mit Motte
Helmuth Schönauer, 29-07-2024
