Angelika Reitzer, Blauzeug
 Wie Sand im Stundenglas pendelt jedes Gedicht zwischen Theorie und Anwendung hin und her und häuft dabei Zeit als Gutschrift für die Ewigkeit an.
Wie Sand im Stundenglas pendelt jedes Gedicht zwischen Theorie und Anwendung hin und her und häuft dabei Zeit als Gutschrift für die Ewigkeit an.
Angelika Reitzer spielt in ihren Gedichten stets mit offenen Karten, indem sie die Kompositionstheorie permanent durchschimmern lässt. Man nehme eine durchschlagende Farbstimmung und bearbeite sie mit dem passenden Werkzeug. „Blauzeug“ entwickelt sich dabei als durchschlagendes Motiv, das sich durch Tage, Jahreszeiten oder Lebensabschnitte ziehen kann.

 Große Ereignisse schicken in der Mythologie oft Kometen als Vorboten, damit die Menschen nach oben schauen und wach werden für das Neue, das nun über sie herfällt.
Große Ereignisse schicken in der Mythologie oft Kometen als Vorboten, damit die Menschen nach oben schauen und wach werden für das Neue, das nun über sie herfällt. Manche Bücher verhexen das Fachpublikum mit ihren schlauen neuen Erzählstrategien, andere wirken auf das alltägliche Sprechgeschehen ein wie der sprichwörtliche Gassenhauer für einfache Handgriffe.
Manche Bücher verhexen das Fachpublikum mit ihren schlauen neuen Erzählstrategien, andere wirken auf das alltägliche Sprechgeschehen ein wie der sprichwörtliche Gassenhauer für einfache Handgriffe. Das Unerfüllbare / fülle ich / mit Unerfüllbarem. (16) ‒ Selten ist die Absicht der Lyrik so klar formuliert wie in der „Stunde der Wintervögel“. Dieser magische Titel kreist scheinbar um das gängige Hauptmotiv der Gegenwartslyrik, den Vögeln, in Wirklichkeit aber ist ein poetischer Teppich über das Land gelegt, aus dem wie in alten Zeiten des Teppich-Klopfens Gebrauchspartikel der unmittelbaren Gegenwart geschüttelt werden.
Das Unerfüllbare / fülle ich / mit Unerfüllbarem. (16) ‒ Selten ist die Absicht der Lyrik so klar formuliert wie in der „Stunde der Wintervögel“. Dieser magische Titel kreist scheinbar um das gängige Hauptmotiv der Gegenwartslyrik, den Vögeln, in Wirklichkeit aber ist ein poetischer Teppich über das Land gelegt, aus dem wie in alten Zeiten des Teppich-Klopfens Gebrauchspartikel der unmittelbaren Gegenwart geschüttelt werden.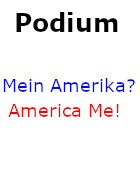 Zumindest in der Literatur, sagt man, kann es Austria mit Amerika aufnehmen. Und dann werden gleich wuchtige Beispiele von Kürnberger, Kafka, Roth und Handke genannt, worin von Europa aus ein kontinentales Weltbild von Amerika entwickelt worden ist.
Zumindest in der Literatur, sagt man, kann es Austria mit Amerika aufnehmen. Und dann werden gleich wuchtige Beispiele von Kürnberger, Kafka, Roth und Handke genannt, worin von Europa aus ein kontinentales Weltbild von Amerika entwickelt worden ist.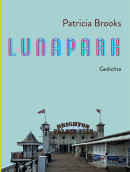 Im Idealfall beschreibt ein einziges Wort einen Kosmos voller Gefühle, Erinnerungen und Träume. In der Lyrik sind diese Zauberbegriffe oft in rätselhaften Gedichten versteckt, manchmal werden sie auf das Cover gespült und schalten dabei das Licht an für eine wundersame Imagination – Lunapark.
Im Idealfall beschreibt ein einziges Wort einen Kosmos voller Gefühle, Erinnerungen und Träume. In der Lyrik sind diese Zauberbegriffe oft in rätselhaften Gedichten versteckt, manchmal werden sie auf das Cover gespült und schalten dabei das Licht an für eine wundersame Imagination – Lunapark.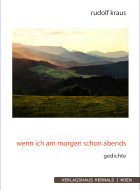 Lyrik ist immer auch eine Zeitmaschine, in den Gedichten geschieht geradezu selbstverständlich, dass etwas in die Zukunft gehoben wird, das noch gar nicht die Gegenwart erreicht hat. Rudolf Kraus überschreibt seine Gedichte mit dem schönen Zeitschieber-Satz: „wenn ich am morgen schon abends“. Das lyrische Ich scheint die Gedanken nachhaltig zu fassen, zumindest für einen ganzen Tag sollten sie Gültigkeit haben.
Lyrik ist immer auch eine Zeitmaschine, in den Gedichten geschieht geradezu selbstverständlich, dass etwas in die Zukunft gehoben wird, das noch gar nicht die Gegenwart erreicht hat. Rudolf Kraus überschreibt seine Gedichte mit dem schönen Zeitschieber-Satz: „wenn ich am morgen schon abends“. Das lyrische Ich scheint die Gedanken nachhaltig zu fassen, zumindest für einen ganzen Tag sollten sie Gültigkeit haben. Lyrik sucht zwischendurch sogenannte lost places auf, worin sie mit den Augen einer überreizten Gegenwart in den Bildern abgeschlossenen Verfalls wühlt. Udo Kawasser siedelt sein Poem rund um die etruskische Stadt Tarquinia an, die neben den Gebilden der Gegenwart vor allem aus Ausgrabungen, Mythos, historischen Befunden und Artefakten des Totenkultes besteht. Wo immer eine lyrische Messstation im Gelände aufgestellt wird, versammelt sich sofort poetische Materie drum herum.
Lyrik sucht zwischendurch sogenannte lost places auf, worin sie mit den Augen einer überreizten Gegenwart in den Bildern abgeschlossenen Verfalls wühlt. Udo Kawasser siedelt sein Poem rund um die etruskische Stadt Tarquinia an, die neben den Gebilden der Gegenwart vor allem aus Ausgrabungen, Mythos, historischen Befunden und Artefakten des Totenkultes besteht. Wo immer eine lyrische Messstation im Gelände aufgestellt wird, versammelt sich sofort poetische Materie drum herum.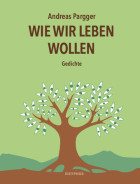 Der sogenannte Lebensstil lässt sich oft kunstvoll zu einem Stillleben zusammenfassen, das sich als Bild oder Gedicht präsentiert. Andreas Pargger unternimmt im Lyrikband „Wie wir leben wollen“ gut fünfzig Anläufe, um sogenannte Lebensentwürfe auszuprobieren. Dabei poppen die Gedichte als Momentaufnahmen auf, in denen sich ein dramatischer Prozess ablesen lässt wie bei einem Poster, das einen besonderen Gestus einer Rolle in den Vordergrund stellt.
Der sogenannte Lebensstil lässt sich oft kunstvoll zu einem Stillleben zusammenfassen, das sich als Bild oder Gedicht präsentiert. Andreas Pargger unternimmt im Lyrikband „Wie wir leben wollen“ gut fünfzig Anläufe, um sogenannte Lebensentwürfe auszuprobieren. Dabei poppen die Gedichte als Momentaufnahmen auf, in denen sich ein dramatischer Prozess ablesen lässt wie bei einem Poster, das einen besonderen Gestus einer Rolle in den Vordergrund stellt. Was sich wie die Grundrechenarten für eine aufgelöste Seele anhört, ist ein lyrisches Konzept, das sich wie ein Stützkorsett um das zerbrechliche Individuum legt. Sirka Elspaß verfasst Gedichte über existentielle Gefühle und emotionale Kämpfe, die sich als variantenreiche lyrische Grundrechenarten an den Begriffen „hungern beten heulen schwimmen“ ablagern.
Was sich wie die Grundrechenarten für eine aufgelöste Seele anhört, ist ein lyrisches Konzept, das sich wie ein Stützkorsett um das zerbrechliche Individuum legt. Sirka Elspaß verfasst Gedichte über existentielle Gefühle und emotionale Kämpfe, die sich als variantenreiche lyrische Grundrechenarten an den Begriffen „hungern beten heulen schwimmen“ ablagern.