Martin Dragosits – Podium Porträt 131
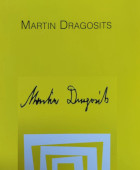 Gedichte sind wie seltene Erden, hoch gefragt, aber schwer zu schürfen. Es bedarf freundschaftlicher Unterstützung, um als Leser zu jener Rarität vorzudringen, die uns oft nur für wenige Augenblicke berührt.
Gedichte sind wie seltene Erden, hoch gefragt, aber schwer zu schürfen. Es bedarf freundschaftlicher Unterstützung, um als Leser zu jener Rarität vorzudringen, die uns oft nur für wenige Augenblicke berührt.
Ein Werkzeug zum Schürfen dieser Gedichte ist die Serie „Podium Porträt“. Dabei wird im bewährten Postkartenformat das lyrische Werk von Zeit-Genießenden vorgestellt, die dabei Gedichte oder Kurzprosa verfassen. Denn die Zeit wird in diesen Sphären in Vers-Einheiten oder Gedankenschüben gemessen, meist ist es fünf vor zwölf, manchmal auch schon etwas später.

 Lyrik wird gespeist aus einem Befinden, das als Ur-Ozean bezeichnet wird. Der Essayist Alexander Kluge vermutet von diesem Urzustand, dass er den Subjekten eine stabile Körpertemperatur vermittelt, die ungefähr bei 37 Grad liegt.
Lyrik wird gespeist aus einem Befinden, das als Ur-Ozean bezeichnet wird. Der Essayist Alexander Kluge vermutet von diesem Urzustand, dass er den Subjekten eine stabile Körpertemperatur vermittelt, die ungefähr bei 37 Grad liegt. Mit zunehmendem Alter wird der Schreibtisch der Boomer und Beamten immer aufgeräumter. Letztlich bleibt nur ein Stehkalender übrig, der zu Ende geblättert ist.
Mit zunehmendem Alter wird der Schreibtisch der Boomer und Beamten immer aufgeräumter. Letztlich bleibt nur ein Stehkalender übrig, der zu Ende geblättert ist. In der Lyrik und in der Fotografie kommt es vor allem auf das Licht an. Beim ersten Einsetzen der Dämmerung lässt sich eine erste Bilanz ziehen: Wie war das Licht des Tages und welche Bilder hat es zugelassen?
In der Lyrik und in der Fotografie kommt es vor allem auf das Licht an. Beim ersten Einsetzen der Dämmerung lässt sich eine erste Bilanz ziehen: Wie war das Licht des Tages und welche Bilder hat es zugelassen?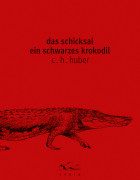 Das Krokodil frisst dem Kasperl aus der Hand, wenn ängstliche Kinder zusehen. Außerhalb der Bühne frisst es freilich alles, woran Menschen hängen – die entlegene Kindheit, den hübschen Körper, die geliebten Angehörigen.
Das Krokodil frisst dem Kasperl aus der Hand, wenn ängstliche Kinder zusehen. Außerhalb der Bühne frisst es freilich alles, woran Menschen hängen – die entlegene Kindheit, den hübschen Körper, die geliebten Angehörigen. Gedichte wühlen uns auf, wenn sie uns in flagranti im Alltag erwischen. Sie erwärmen uns, wenn sie Ordnung ins Tagwerk bringen, sie schärfen unsere Sinne, wenn sie uns die beiläufige Petitesse als Teil eines Weltdramas zeigen.
Gedichte wühlen uns auf, wenn sie uns in flagranti im Alltag erwischen. Sie erwärmen uns, wenn sie Ordnung ins Tagwerk bringen, sie schärfen unsere Sinne, wenn sie uns die beiläufige Petitesse als Teil eines Weltdramas zeigen. Zwölf Wiener Dialektlieder auf CD, ein Booklet mit den Texten im Dialekt und in einer interlinearen Übertragung, Biographien der Künstler, prägnante musikhistorische Annotation – beglücktes Herz, was willst du mehr!
Zwölf Wiener Dialektlieder auf CD, ein Booklet mit den Texten im Dialekt und in einer interlinearen Übertragung, Biographien der Künstler, prägnante musikhistorische Annotation – beglücktes Herz, was willst du mehr!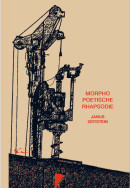 Auch für Bücher gilt: das Unerwartete macht oft die größte Freude. Janus Zeitstein stiftet mit seiner „Morphopoetische Rhapsodie“ einen Moment lang Verwirrung, um dann die Leser mit beinahe magnetischem Glücksversprechen ins Buchinnere zu ziehen.
Auch für Bücher gilt: das Unerwartete macht oft die größte Freude. Janus Zeitstein stiftet mit seiner „Morphopoetische Rhapsodie“ einen Moment lang Verwirrung, um dann die Leser mit beinahe magnetischem Glücksversprechen ins Buchinnere zu ziehen. Ein Geograph stellt sich die Poesie vielleicht als Gebirge vor, in das verschiedene Adern von Erzen eingelassen sind, ein Mathematiker als eine Formel, in der ständig neue Unbekannte auftreten, und ein Zoologe vielleicht als Schatten von Vögeln, die gerade ausgestorben sind.
Ein Geograph stellt sich die Poesie vielleicht als Gebirge vor, in das verschiedene Adern von Erzen eingelassen sind, ein Mathematiker als eine Formel, in der ständig neue Unbekannte auftreten, und ein Zoologe vielleicht als Schatten von Vögeln, die gerade ausgestorben sind.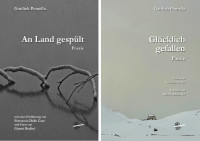 Meist sind es die Antriebskräfte Aufbruch und Ausklang, die Menschen Gedichte formen lassen, um für sich etwas Klarheit zu schaffen über die seltsamen Vorgänge rund ums Leben.
Meist sind es die Antriebskräfte Aufbruch und Ausklang, die Menschen Gedichte formen lassen, um für sich etwas Klarheit zu schaffen über die seltsamen Vorgänge rund ums Leben.