Alexander Peer, Gin zu Ende, achtzehn Uhr
 Je nach Gemüt, Stimmung oder Zustand der intellektuellen Datenbank bringt Lyrik bei der Rezeption eine Menge Sichtweisen ins Spiel. Die zwei wichtigsten sind immer: Schlüsselwörter und Konzeption.
Je nach Gemüt, Stimmung oder Zustand der intellektuellen Datenbank bringt Lyrik bei der Rezeption eine Menge Sichtweisen ins Spiel. Die zwei wichtigsten sind immer: Schlüsselwörter und Konzeption.
Damit ist gemeint, dass es vor allem Reizbegriffe und Schlüsselwörter sind, die das Individuum zum Erklingen und Erschüttern bringen, wenn es einen lyrischen Text liest. Die zweite Komponente ist die sogenannte Konzeption, damit ist jenes Programm gemeint, auf das sich die urhebende Person stützt. Die steilste Form der Lyrik ist demnach die Konzeptlyrik. Dabei wird zwar ein Programm beschrieben, die Ausführung wird aber den Anwendern überlassen.

 Wenn ein physikalisches Thema mit einem Nobelpreis für Physik ausgestattet wird, sollte dann nicht auch in der Lyrik dieses Thema aufgegriffen werden?
Wenn ein physikalisches Thema mit einem Nobelpreis für Physik ausgestattet wird, sollte dann nicht auch in der Lyrik dieses Thema aufgegriffen werden? Bücherfreunde wissen: Die Steigerung von Buch heißt Umkehrbuch. Das ist eine Art U-Turn, wie man ihn im Rallye-Sport kennt. Man hält das Buch wie immer, macht einen U-Turn, und hat plötzlich ein anderes Buch in der Hand. Die erste Frage bei der Lektüre eines Split-Buches lautet folglich: Was lese ich zuerst? Lese ich in einem Zug bis zur Mitte, oder wechsle ich nach jedem Gedicht die Buchhälfte?
Bücherfreunde wissen: Die Steigerung von Buch heißt Umkehrbuch. Das ist eine Art U-Turn, wie man ihn im Rallye-Sport kennt. Man hält das Buch wie immer, macht einen U-Turn, und hat plötzlich ein anderes Buch in der Hand. Die erste Frage bei der Lektüre eines Split-Buches lautet folglich: Was lese ich zuerst? Lese ich in einem Zug bis zur Mitte, oder wechsle ich nach jedem Gedicht die Buchhälfte?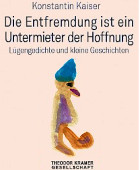 Titel sagen mittlerweile weniger darüber aus, was in einem Buch drinsteht, als vielmehr was der Leserschaft zugemutet wird.
Titel sagen mittlerweile weniger darüber aus, was in einem Buch drinsteht, als vielmehr was der Leserschaft zugemutet wird.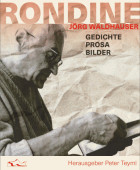 Vor Jahrzehnten, als die Heranwachsenden noch hirnlos in den Tag hineinstudiern konnten und anschließend einen Job ins Maul geflogen bekamen, machte in Tirol ein seltsames Gerücht die Runde: In Hall sitzt in der Nudelfabrik während der Nacht ein Philosoph an der Pforte und sinniert während seiner Aufsicht über den Sinn der Welt nach.
Vor Jahrzehnten, als die Heranwachsenden noch hirnlos in den Tag hineinstudiern konnten und anschließend einen Job ins Maul geflogen bekamen, machte in Tirol ein seltsames Gerücht die Runde: In Hall sitzt in der Nudelfabrik während der Nacht ein Philosoph an der Pforte und sinniert während seiner Aufsicht über den Sinn der Welt nach.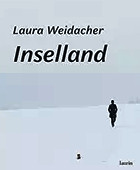 Was für eine Verheißung! Inselland – ein doppeltes Glücksversprechen, wenn die lyrische Seele sich auf eine Insel zurückzieht und gleichzeitig über weites Land schwebt.
Was für eine Verheißung! Inselland – ein doppeltes Glücksversprechen, wenn die lyrische Seele sich auf eine Insel zurückzieht und gleichzeitig über weites Land schwebt. Der wissenschaftlichste Witz aller Zeiten geht in etwa so: Ein Witz kommt auf die Bühne und erklärt, dass er ein Witz sei.
Der wissenschaftlichste Witz aller Zeiten geht in etwa so: Ein Witz kommt auf die Bühne und erklärt, dass er ein Witz sei. Wo Goethes Faust nicht überall hinlangt! – In Marthens Garten wird gerade die Gretchenfrage gestellt, da kommt es schon zum berühmten Diktum: „Gefühl ist alles. Namen sind nur Schall und Rauch.“
Wo Goethes Faust nicht überall hinlangt! – In Marthens Garten wird gerade die Gretchenfrage gestellt, da kommt es schon zum berühmten Diktum: „Gefühl ist alles. Namen sind nur Schall und Rauch.“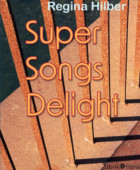 Bist du ein Verschließungs- oder ein Erschließungsgedicht? – Gedichte vertragen es durchaus, wenn man sie in einem witzigen Ton etwas fragt, ähnlich wie man sich bei Kindern nach dem Lieblingsspielzeug erkundigt.
Bist du ein Verschließungs- oder ein Erschließungsgedicht? – Gedichte vertragen es durchaus, wenn man sie in einem witzigen Ton etwas fragt, ähnlich wie man sich bei Kindern nach dem Lieblingsspielzeug erkundigt. „Mein Gedicht ist mein Messer“ schreibt Hans Magnus Enzensberger 1961 und lässt erahnen, was ein Gedicht letztlich bewirken kann: Nämlich eine Epoche, ein subjektives Zeitgefühl und das historische Bewusstsein zu zerschneiden in vorher und nachher.
„Mein Gedicht ist mein Messer“ schreibt Hans Magnus Enzensberger 1961 und lässt erahnen, was ein Gedicht letztlich bewirken kann: Nämlich eine Epoche, ein subjektives Zeitgefühl und das historische Bewusstsein zu zerschneiden in vorher und nachher.