Richard Wall, Achill
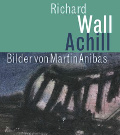 Ein heroischer Titel, Bilder von der unterirdischen Gewalt einer Kontinental-Drift, Gedichte ausgerichtet wie ein Flügelaltar, ein Nobelpreisträger auf den kargen Boden irdischer Lebenserfahrung zurückgeholt - so fühlt sich ein Gesamtkunstwerk aus den Händen von Richard Wall und Martin Anibas an.
Ein heroischer Titel, Bilder von der unterirdischen Gewalt einer Kontinental-Drift, Gedichte ausgerichtet wie ein Flügelaltar, ein Nobelpreisträger auf den kargen Boden irdischer Lebenserfahrung zurückgeholt - so fühlt sich ein Gesamtkunstwerk aus den Händen von Richard Wall und Martin Anibas an.
Richard Wall ist der Meister des Randes, der Peripherie, des Endes einer urbanen Welt. So beobachtet und beschützt er seit Jahrzehnten die Westküste Irlands, bringt dabei die Urelemente einer wütenden Küste als Bilder und Gedichte zurück und beobachtet das Vordringen der sogenannten Zivilisation bis in die letzte Ritze der Küste hinein.

 Wer einmal länger in ein Aquarium geschaut hat, kann sich durchaus vorstellen, dass eigentlich die Fische die Beobachter sind, die sich an den kiemenlosen Gaffern köstlich amüsieren.
Wer einmal länger in ein Aquarium geschaut hat, kann sich durchaus vorstellen, dass eigentlich die Fische die Beobachter sind, die sich an den kiemenlosen Gaffern köstlich amüsieren. Den besten Stoff für Literatur bietet allemal das Leben selbst und das verrückteste Glück lässt sich nur in der Literatur finden.
Den besten Stoff für Literatur bietet allemal das Leben selbst und das verrückteste Glück lässt sich nur in der Literatur finden.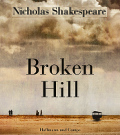 Wenn ein Ort richtig entlegen ist, fällt er mit einer Handbewegung aus Raum und Zeit. Broken Hill ist ein abgewirtschafteter Bergbau-Ort im tiefsten Australien. Mit der schrottreifen Eisenbahn ist es leichter über die Küste nach London zu gelangen als nach Sidney.
Wenn ein Ort richtig entlegen ist, fällt er mit einer Handbewegung aus Raum und Zeit. Broken Hill ist ein abgewirtschafteter Bergbau-Ort im tiefsten Australien. Mit der schrottreifen Eisenbahn ist es leichter über die Küste nach London zu gelangen als nach Sidney. Auch wenn der Kapitalismus noch so sehr darauf pocht, dass man die Welt besitzen könne, Landschaften jedenfalls lassen sich nicht besitzen, sondern nur leihen. Damit gleichen sie unseren besten Büchern in den Bibliotheken, deren Inhalt man zwar besitzen kann, wenn man ihn gelesen hat, deren Korpus aber nur geliehen ist.
Auch wenn der Kapitalismus noch so sehr darauf pocht, dass man die Welt besitzen könne, Landschaften jedenfalls lassen sich nicht besitzen, sondern nur leihen. Damit gleichen sie unseren besten Büchern in den Bibliotheken, deren Inhalt man zwar besitzen kann, wenn man ihn gelesen hat, deren Korpus aber nur geliehen ist. Wenn man das letzte Bild von jemandem im Album hat, hat man dann sein ganzes Leben vor Augen?
Wenn man das letzte Bild von jemandem im Album hat, hat man dann sein ganzes Leben vor Augen?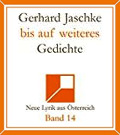 Die Lyrik fließt nicht nur als feierliches Brimborium, als spitze Spreche oder abgeklärter Lesebucheintrag durchs Land, die wilde Lyrik ist oft unauffällig, selbstkritisch und politisch in ihrer Verweigerung des tagespolitischen Geplänkels.
Die Lyrik fließt nicht nur als feierliches Brimborium, als spitze Spreche oder abgeklärter Lesebucheintrag durchs Land, die wilde Lyrik ist oft unauffällig, selbstkritisch und politisch in ihrer Verweigerung des tagespolitischen Geplänkels.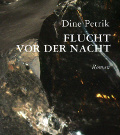 Letztlich sind viele Typen prädestiniert, sich vor der Nacht zu fürchten. Die Kinder, wenn sie mit Gruselprogramm zu Bett gebracht worden sind, die erotisch Inspirierten, wenn das Tun nicht mehr mit dem Wollen übereinstimmt, die Künstler, wenn sie in der Finsternis dem aufgeklärten Licht ihrer Werke entrückt sind.
Letztlich sind viele Typen prädestiniert, sich vor der Nacht zu fürchten. Die Kinder, wenn sie mit Gruselprogramm zu Bett gebracht worden sind, die erotisch Inspirierten, wenn das Tun nicht mehr mit dem Wollen übereinstimmt, die Künstler, wenn sie in der Finsternis dem aufgeklärten Licht ihrer Werke entrückt sind. Die höchste Kunst des Erzählens ist die Auflösung von Ort, Zeit und Handlung, sie führt vielleicht zu einem anderen Tod.
Die höchste Kunst des Erzählens ist die Auflösung von Ort, Zeit und Handlung, sie führt vielleicht zu einem anderen Tod. In der Pionierphase des Poetry Slam waren die Auftritte der Künstler oft ein illuminierter Wutschrei, und die ersten Bücher darüber waren unlesbare Niederschriften leicht depressiver Monologisten. Mittlerweile ist Poetry Slam eine kontinental verbreitete literarische Giga-Form mit eigener Geschichte, mitreißenden Ritualen und ausgewiesenen Experten an Bord.
In der Pionierphase des Poetry Slam waren die Auftritte der Künstler oft ein illuminierter Wutschrei, und die ersten Bücher darüber waren unlesbare Niederschriften leicht depressiver Monologisten. Mittlerweile ist Poetry Slam eine kontinental verbreitete literarische Giga-Form mit eigener Geschichte, mitreißenden Ritualen und ausgewiesenen Experten an Bord.