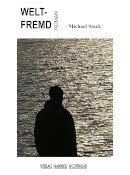 Nach dem Koma ist nur eines gewiss: Alles, was bei den Sinnesorganen hereinschaut, ist etwas Fremdes. Zwischen der Welt und dem Individuum fremdelt es.
Nach dem Koma ist nur eines gewiss: Alles, was bei den Sinnesorganen hereinschaut, ist etwas Fremdes. Zwischen der Welt und dem Individuum fremdelt es.
Michael Stark erzählt aus der Innensicht eines Helden, der eigentlich keine Sprache, keine Erinnerung und keinen Realitätssinn hat. Als Ich-Erzähler, der offensichtlich als Drehbuchautor früher ganze Welten erfinden und erschreiben konnte, ist er jetzt darauf angewiesen, seinen eigenen Zustand in irgendwas Sprachliches zu fassen, das vorläufig nur als sinnlose Wortpartikel durch seinen Kopf geistert.
Der Roman handelt also davon, wie jemand wieder in die Welt zurückkehrt, aus der er durch ein Koma ausgestiegen ist. Kann die sogenannte frühere Welt rekonstruiert oder gar restauriert werden? Oder muss ohnehin etwas Neues her, aber was, wenn man keine Vorstellung von der Welt hat?
Die Gedanken rasen als kleine Satzfetzen durch den Kopf und gleichen jenem Sand, der an der aktuellsten Stelle durch die Zeit rinnt. Andererseits verströmen diese Impulse einen permanenten Beat, der als Urmusik durch die Adern pocht.
Die Gedanken ordnen sich allmählich zu einer Spurensuche nach dem ausgeblendeten Leben, dadurch hat der Roman etwas von einer Bildungsstrategie an sich, indem eins auf das andere aufbaut und eine Art Logik imaginiert.
Was in der Natur in vier Jahreszeiten abläuft, ist hier mit vier Orientierungshilfen beim Sortieren als Überschrift ausgeführt:
Dunkle Gestalten | Hohlräume | Am Strand | Objekte im Park.
Aus dem puren Atmen heraus ergibt sich die erste Frage: Wie ist das alles passiert? Während die meiste Zeit des Tages sogenannte „dunkle Gestalten“ durch den Kopf jagen, sind im Text ab und zu Sätze schräg gedruckt und geben echte Sätze wieder, die sich zu einem Dialog mit anwesenden Personen am Bett auswachsen könnten. „Wie soll es weitergehen?“ (11) Der dominierende Zustand ist Erschöpfung.
Ohne genaue Zeitangabe, einfach später, ist der Erzähler als Figur in einem minimalistischen Bild in einem Park unterwegs, Baum und Bank genügen als Orientierung. Zudem beginnt er mit dem Aufschreiben kleiner Wortgruppen, seit man ihm gesagt hat, dass er früher etwas mit dem Schreiben zu tun gehabt hat. Dieses Schreiben will keine Antworten auf Nichts, es ist für ihn eine Isolierschicht zur Welt: Denn sein Schreiben ist kalt! (70)
Im nächsten Abschnitt ist die Erinnerung an früher in Ruckelbildern hergestellt. Seine große Liebe hat über den Strand von damals Eingang gefunden in seinen jetzigen Zustand. Aber es gibt ein Problem. Wenn die Welt von damals verloren gegangen ist, ist auch die Liebe verloren. Wenn man sie neu knüpfen wollte, wäre sie nicht mehr die alte. Man müsste bei Null beginnen. „Es hat keinen Sinn“, sagen abwechselnd beide, der Rekonvaleszente und sie, die ihm bei der Rekonstruktion einer womöglich ausgedachten Welt hilft.
Noch immer ist das Zeitgefühl abwesend, aber Musik hat sich inzwischen bei der Denkarbeit eingestellt und wird zum tragenden Element.
Objekte im Park heißt das letzte Bild, das schon komplexe Zusammenhänge zeigt, auch wenn diese noch immer mit einfachen Sätzen zusammengesetzt sind.
In Fragmenten schleichen sich sogar Emotionen ein, etwa wenn ein Vogel als etwas Besonderes und vielleicht Schönes empfunden wird. Die Gespräche mit der Freundin erreichen beinahe wieder Drehbuchformat und stellen die nächste Falle auf. Wenn wir jetzt wieder ganze Geschichten entwickeln, für wen sind sie? Arbeiten wir vielleicht an einem Drehbuch, das nicht mit unserer Geschichte kompatibel ist.
„Es wird sich wieder einstellen.“ (163)
Eine Verbesserung des Zustands lässt sich in minimalistischen Szenen darstellen, wie es beim Auskleiden eines Drehbuches mit Bildern notwendig ist.
„Er inspiziert die abgewitterten Steinskulpturen / Objekte im Park / Wie sie aufeinander verweisen / Ein Gesamtkunstwerk / Er steigt auf ihnen herum / Weil es nicht erlaubt ist“ (181)
Im Schlussbild sitzt der Erzähler am Teich und lässt Steine über das Wasser springen als Sätze, die plötzlich selbständige Wesen sind. Er hat eine größere Sache mit jener Frau im Sinn, die Zukunft mit Vergangenheit verbindet, und sie hat schon gelacht und ist auf dem Weg zu ihm.
Michael Stark verlässt sich auf die Kraft der Literatur, um ein Schicksal zu beschreiben, das ihm selbst keinesfalls „weltfremd“ ist. Über die Kunst der Rekonstruktion gelingt es ihm, eine verloren geglaubte Welt so aufzubereiten, dass sie erzählbar wird.
Dazu dient der Erzählrhythmus, der phasenweise einer Beatmungsmaschine nachempfunden ist. Die kurzen Sätze kreisen wie Atome um den Prozess des Aufwachens und geben allmählich die Geschichte frei. Die drei „Künste“ Reden – Musik – Schreiben erweisen sich als Haltegriffe, an denen man sich vortasten könnte, wenn man aus irgendeinem Grund „weltfremd“ unterwegs ist.
Michael Stark, Weltfremd. Roman
St. Johann: Verlag Hannes Hofinger 2025, 184 Seiten, 18,00 €, ISBN 978-3-9505702-0-5
Weiterführender Link:
Verlag Hannes Hofinger
Helmuth Schönauer, 07-05-2025
