Stefan Soder, Schorsch
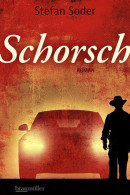 Wenn die Stimmung im Land wieder einmal bedrückend wird, hilft manchmal ein Roman nach der Vorlage von Kleists Michael Kohlhaas, damit man sich mit dem Helden identifizieren, mit ihm kämpfen und mit ihm in Würde untergehen kann.
Wenn die Stimmung im Land wieder einmal bedrückend wird, hilft manchmal ein Roman nach der Vorlage von Kleists Michael Kohlhaas, damit man sich mit dem Helden identifizieren, mit ihm kämpfen und mit ihm in Würde untergehen kann.
Stefan Soder stiftet der Literatur mit dem „Schorsch“ einen sympathischen Helden, der in einer Welt des wirtschaftlichen Umbruchs mit der bewährten Tradition des Bauer-Seins Schiffbruch erleidet. Der Plot ist speedy wie das Netz, ständig zweigen aus dem Hauptstrang elementare Reibereien ab, die den Roman in seiner Dramaturgie bald zu einem gedachten Film werden lassen, den weder Personal noch Regie stoppen können.

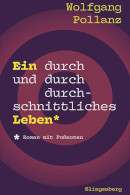 Sobald man das Mittelmaß von etwas zu ermitteln versucht, treten die Extreme und Extravaganzen unkündbar in den Vordergrund. Ein durchschnittliches Leben zu ermitteln, führt in der Literatur verlässlich zu einem Heldenepos, in dem sich die Protagonisten nicht gegen ihre wahrhaftige Bedeutung zur Wehr setzen können.
Sobald man das Mittelmaß von etwas zu ermitteln versucht, treten die Extreme und Extravaganzen unkündbar in den Vordergrund. Ein durchschnittliches Leben zu ermitteln, führt in der Literatur verlässlich zu einem Heldenepos, in dem sich die Protagonisten nicht gegen ihre wahrhaftige Bedeutung zur Wehr setzen können.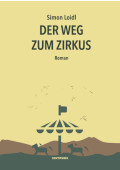 Ein echter Zirkus verwandelt jene Glücksvorstellungen, die im Laufe einer Kindheit aufgekeimt sind, in raren Fällen bei Erwachsenen zu einem realen Paradies. Der Weg zum Zirkus ist jedenfalls wie die meisten Bildungswege holprig und absonderlich.
Ein echter Zirkus verwandelt jene Glücksvorstellungen, die im Laufe einer Kindheit aufgekeimt sind, in raren Fällen bei Erwachsenen zu einem realen Paradies. Der Weg zum Zirkus ist jedenfalls wie die meisten Bildungswege holprig und absonderlich.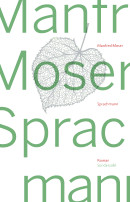 Gegen Jahresende greift man die Bücher mit besonderer Ehrfurcht an, allzu oft überfällt einen dabei das letzte Aufzucken einer Epoche, von der man noch einen Zipfel Aktualität ergattert.
Gegen Jahresende greift man die Bücher mit besonderer Ehrfurcht an, allzu oft überfällt einen dabei das letzte Aufzucken einer Epoche, von der man noch einen Zipfel Aktualität ergattert.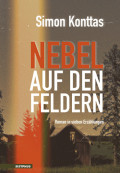 Bilder als Titel lösen spontan Sehnsüchte aus, die sich aus Musik und Literatur zu einem bestimmten Thema aufgestaut haben. Sobald „Nebel auf den Feldern“ als Cover vor den Leseaugen auftaucht, beginnt eine Musik nach finnischer Art zu erklingen, die Landschaft wird weit und „finnisch“, und wenn sich dann noch der Nebel auf die Felder legt, beginnen die Seelen der Bewohner zu flirren, deren Schicksale von einem wechselnden Schleier an Stimmung zusammengehalten werden.
Bilder als Titel lösen spontan Sehnsüchte aus, die sich aus Musik und Literatur zu einem bestimmten Thema aufgestaut haben. Sobald „Nebel auf den Feldern“ als Cover vor den Leseaugen auftaucht, beginnt eine Musik nach finnischer Art zu erklingen, die Landschaft wird weit und „finnisch“, und wenn sich dann noch der Nebel auf die Felder legt, beginnen die Seelen der Bewohner zu flirren, deren Schicksale von einem wechselnden Schleier an Stimmung zusammengehalten werden.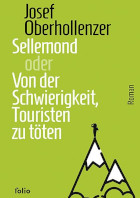 Widerstand, Eigenart und Selbstbewusstsein der Südtiroler resultieren aus dem täglichen Überlebenskampf des Individuums inmitten der Massen. Josef Oberhollenzer zeigt in seinen Romanen immer wieder, dass es sich lohnt, ein Individuum zu sein. Denn es sind immer die Massen, die einsam sind, ‒ die Einzelgänger sind nämlich umkost von Kunst und Literatur.
Widerstand, Eigenart und Selbstbewusstsein der Südtiroler resultieren aus dem täglichen Überlebenskampf des Individuums inmitten der Massen. Josef Oberhollenzer zeigt in seinen Romanen immer wieder, dass es sich lohnt, ein Individuum zu sein. Denn es sind immer die Massen, die einsam sind, ‒ die Einzelgänger sind nämlich umkost von Kunst und Literatur.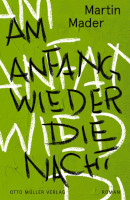 Wer das erste Mal durch Zufall oder als Geheimtipp in das Darknet geraten ist, wird hinterher nur schwer beschreiben können, was er darin gesehen hat. Martin Mader entführt mit dem Roman „Am Anfang wieder die Nacht“ die Leser in ein Darknet, worin alles vorkommt, was man sich in einer Gegenwelt erwarten möchte: Dunkelheit, Exzesse, Geld, Drogen, Waffen, Verschwörungen, Geschäfte.
Wer das erste Mal durch Zufall oder als Geheimtipp in das Darknet geraten ist, wird hinterher nur schwer beschreiben können, was er darin gesehen hat. Martin Mader entführt mit dem Roman „Am Anfang wieder die Nacht“ die Leser in ein Darknet, worin alles vorkommt, was man sich in einer Gegenwelt erwarten möchte: Dunkelheit, Exzesse, Geld, Drogen, Waffen, Verschwörungen, Geschäfte.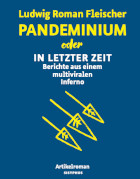 Die wahren Helden der Zeitgeschichte sind oft Medien, die sich mit einem kleinen Taschenmesser einen Weg durch den Dschungel der Meinungen schlagen. Dabei liegt die wahre Regierung über den kleinteiligen Zeitgeist meist als Impressum einer unscheinbaren Kleinzeitung auf.
Die wahren Helden der Zeitgeschichte sind oft Medien, die sich mit einem kleinen Taschenmesser einen Weg durch den Dschungel der Meinungen schlagen. Dabei liegt die wahre Regierung über den kleinteiligen Zeitgeist meist als Impressum einer unscheinbaren Kleinzeitung auf.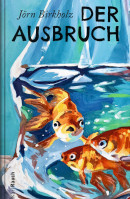 Das Wort „plötzlich“ leitet in der Literatur oft einen Ausbruch ein. Kluge Leser wissen das und blättern im Roman oft von plötzlich zu plötzlich, damit ihnen ja kein Ausbruch als Vulkan, Seuche oder Lebensplanung entgeht.
Das Wort „plötzlich“ leitet in der Literatur oft einen Ausbruch ein. Kluge Leser wissen das und blättern im Roman oft von plötzlich zu plötzlich, damit ihnen ja kein Ausbruch als Vulkan, Seuche oder Lebensplanung entgeht.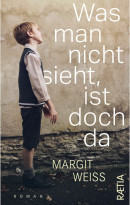 Wenn eine zarte Pflanze verletzt wird, wächst sie geduckt und verwundet auf. – Diese Baumschulweisheit gilt erst recht für Kinder, die in Aufzucht-Institutionen rabiater Systeme unter die Räder gekommen sind. Margit Weiß erzählt vom zehnjährigen Hans Dakosta, der 1954 vom Unterricht abgeholt wird und ohne Wissen seiner Eltern in eine Erziehungsanstalt gesteckt wird. „Was man nicht sieht, ist doch da!“ – Diese Erfahrung, die der junge Held im Erziehungssystem der Tiroler Nachkriegszeit machen muss, wird zu einem leidvollen Leitsatz, mit dem der Held sich über Wasser zu halten versucht. Dabei ist auch diese Fügung schon wieder heimtückisch, denn im großen Schlafsaal der Anstalt spielt Bettnässen eine gewichtige Rolle.
Wenn eine zarte Pflanze verletzt wird, wächst sie geduckt und verwundet auf. – Diese Baumschulweisheit gilt erst recht für Kinder, die in Aufzucht-Institutionen rabiater Systeme unter die Räder gekommen sind. Margit Weiß erzählt vom zehnjährigen Hans Dakosta, der 1954 vom Unterricht abgeholt wird und ohne Wissen seiner Eltern in eine Erziehungsanstalt gesteckt wird. „Was man nicht sieht, ist doch da!“ – Diese Erfahrung, die der junge Held im Erziehungssystem der Tiroler Nachkriegszeit machen muss, wird zu einem leidvollen Leitsatz, mit dem der Held sich über Wasser zu halten versucht. Dabei ist auch diese Fügung schon wieder heimtückisch, denn im großen Schlafsaal der Anstalt spielt Bettnässen eine gewichtige Rolle.