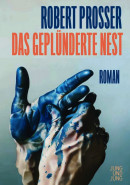 Wie kann man über etwas nachdenken, wenn einem der öffentliche Rummel keinen Platz dafür lässt? Wie kann die Kunst im Untergrund an der Oberfläche des Tagesgeschehens andocken, wenn keine Flächen dafür vorgesehen sind?
Wie kann man über etwas nachdenken, wenn einem der öffentliche Rummel keinen Platz dafür lässt? Wie kann die Kunst im Untergrund an der Oberfläche des Tagesgeschehens andocken, wenn keine Flächen dafür vorgesehen sind?
Robert Prosser erzählt im Roman „Das geplünderte Nest“ vom Untergrund des kollektiven Bewusstseins, das im Museum des Vergessens eingelagert ist. Für das Auffinden der Untergrundgeschichte wählt er einen journalistischen Plot: Ein Ich-Erzähler aus einem Tiroler Alpendorf erforscht, während zu Hause Saison-Rummel ist, die „Graff-Kultur“ im Beirut der Ruinen und Provisorien. Als er für die ruhige Zwischensaison nach Hause kommt, erwartet ihn eine unheimliche Stille. Nach dem Lärm im Kriegsgebiet wirkt das Dorf umso schweige-schriller, als es eben noch die Hölle des touristischen Entertainments inszeniert hat.
Der Erzähler bringt seine Ferienwohnung in Ordnung, die er während seiner Auslandsaufenthalte vermietet, und stellt verwundert fest, dass sich das Thema Untergrund-Kunst in der Kampfzone auch vor der Haustüre abhandeln lassen müsste.
Schon die ersten Fragen bei den raren Dorfbewohnern, die in der Zwischensaison noch aufhältig sind, eröffnen eine wilde Geschichte. Im Ort hat es „seinerzeit“ ein Lager für Fremdarbeiter gegeben, und sein Großvater, von dem er das Haus geerbt hat, war darin Aufseher. Im Gebirge droben hat es als Pendant dazu das sogenannte Nest gegeben, worin sich ein paar wenige Deserteure und Widerstandskämpfer aufhielten.
Die verdrängte Dorfgeschichte lässt sich nur mühsam aus dem Vergessenwollen hervor kratzen, eine Befragte meint sogar, „aber vielleicht habe ich es aus dem Fernsehen“. (72)
Anhand einer kleinen Figur, die ein Abgetauchter im Nest droben geschnitzt hat, rekonstruiert der Erzähler eine doppelte Geschichte.
„Die Gespenster der Gespenster“ handeln vom Lager, dem Nest, den Wärtern, Insassen und der großen Kunst des Anpassens, Mitlaufens und Vergessens. Die Hauptfigur ist Ludwig, der Großvater des Recherchierenden, nach ihm ist auch die Heimstätte Ludwighaus benannt.
„Stillleben mit Hunger“ gibt Einblicke in das Leben eines Künstlerpaares, das zu Kriegsende ins Dorf gezogen ist, um vielleicht eine Künstlerkolonie Alpen (115) zu etablieren. Die Kunst besteht vorerst darin, den Regimewechsel ohne größeren künstlerischen Bruch hinzukriegen. Hauptfigur ist Lenz, ein einarmiger Maler, der den meisten nur als künstlerisch tätiger Sonderling aufgefallen ist.
Beide Erzählstränge betonen immer wieder die eigene Unzulänglichkeit.
„Im Nachhinein ist es leicht, zu fantasieren.“ (167)
Die heimische Bevölkerung ist abgetaucht in einem Brei aus Business und touristischem Fetischismus. Nur wer ausschert, hat Chance auf eine eigene Identität. In der Hauptsaison gibt es zwei Möglichkeiten, die aufgedunsene dörfliche Inszenierung zu überleben.
Einmal als Liftler (54), das sind quasi heimische Leiharbeiter, die spektakulär den Gästen den Liftbügel unter den Arsch schieben, wenn diese „hoch“ wollen.
Und dann gibt es die Giftler (59), die in der Zwischensaison in die leeren Häuser einsteigen und so jedes Bett aus eigener Anschauung kennen. Freund Flo ist so einer, in der Hauptsaison lebt er wie seinerzeit die Dissidenten im Nest und wird dadurch für die Untergrundszenerie zu einer wertvollen Auskunftsquelle.
Robert Prosser verbindet im „geplünderten Nest“ Erzählstrategien aus der Landschaftsreportage mit jenen der Kriegsberichterstattung. Die Helden sind durch historische Fäden unter der Tuchent des Vergessens miteinander verknüpft.
Das Sichtbare, Oberflächliche steht im Widerspruch zum widerborstig Verborgenen. Als markantes Beispiel für diese antagonistische Welt dienen die Graffiti, im Fachjargon des Romans „Graff“ genannt. (Im Volksmund gibt es das Wort Graffl für wertloses Zeug.)
Das ganze Dorfleben lässt sich als Graff lesen, einmal leuchtet es als glitzerndes Panorama voller Hotels und Après-Ski, dann wieder verkriecht es sich in die Wortlosigkeit der Entkräftung während der toten Saison.
Der Roman ist mit zwei wundersamen Manifesten in die Geschichte des Erzählens geklammert.
Zu Beginn sinniert das Ich über die Enge des Gebirges und seiner Katapult-Kraft, sich in die weite Welt schleudern zu lassen.
Am Ende wird im Sinne eines Ausstellungskatalogs die Widerstandspuppe der Dissidenz kommentiert. Zwar sind alle Charaktere des Romans frei erfunden, aber diese Erfindung trifft immer wieder auf reale Personen, die in der Wirklichkeit gewirkt haben wie geschnitzte oder gemalte Graffs.
Robert Prosser, Das geplünderte Nest. Roman
Salzburg: Jung & Jung Verlag 2025, 176 Seiten, 24,70 €, ISBN 978-3-99027-427-9
Weiterführender Link:
Jung & Jung Verlag: Robert Prosser, Das geplünderte Nest
Wikipedia: Robert Prosser
Helmuth Schönauer, 12-09-2025
