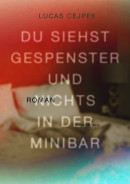 Jeder aufregende Essay ist letztlich eingezwängt zwischen den Extrempositionen der Schwarzmalerei und der Abgeschnittenheit vom erhellenden Stoff.
Jeder aufregende Essay ist letztlich eingezwängt zwischen den Extrempositionen der Schwarzmalerei und der Abgeschnittenheit vom erhellenden Stoff.
Lucas Cejpek verpackt diese Beklemmung in einen wunderbaren Titel. Einerseits wird die Schwarzmalerei relativiert mit der landläufigen Fügung „Du siehst Gespenster“, andererseits wird die desaströse Stimmung angesprochen, wenn im Hotelzimmer zwar der Kühlschrank brummt, aber nichts in der Minibar ist. Wie soll das Individuum etwas Vernünftiges denken, wenn es vom Stoff abgeschnitten ist?
Diese Isolation wird auf den ersten Seiten bedrohlich ausgeweitet, indem eine großangelegte Katastrophe Öffentliches und Privates auf den Kopf stellt. Eine Pandemie hat soeben alle Koordinaten aus ihrer Verankerung gerissen und die Welt neu vermessen.
Als neue Helden der Geschichten tauchen plötzlich Gespenster auf, sie agieren unabhängig von Raum und Zeit und leben vom Überraschungsmoment. Da Gespenster oft nur als Gespinst auftreten, lässt sich über sie auch nicht diskutieren. Der Befallene muss seine Geschichte ganz alleine aussitzen.
Am ehesten hilft noch das Format des Essays, um diese Kobolde des Kopfes in eine Art Ordnung zu zwängen. Der Autor entscheidet sich, ein „Gespensterbuch“ zu verfassen, um den vagen Eindrücken und Irritationen einen Kern zu geben, um den sich die Tagesabläufe wickeln lassen.
Die einzelnen Sequenzen sind lose durch Assoziation verbunden, manchmal wird ihnen wie in einem Abenteuerroman ein bestimmtes Datum und eine bemerkenswerte Stimmungslage zugeschrieben, woraus sich dann eine kleine Geschichte formen lässt.
So wird der Erzähler am Flughafen gefilzt, ob er nicht Gespenster schmuggle, und tatsächlich werden die Zöllner fündig, indem sie auf einen Bleistift stoßen, mit dem sich Geistergeschichten skizzieren lassen. (11)
Anschließend legt jemand Listen an, deren Zweck es ist, eine Liste zu sein.
„Die Liste von allem, was mir Angst macht. / Die Liste von allem, was mir Angst machen sollte. / […] Die Liste der Fragen, die ich mir stellen sollte. / Die Liste der Freiheiten, die ich gewinnen könnte.“ (17)
Die Listen laufen als geheimes Curriculum durch den Essay, manchmal kommt es zu einer unerwarteten Eruption, wenn eine Frage oder Antwort aufbricht. So hängt jemand einen Aushang mit einer Todesnachricht an das schwarze Brett, ohne etwas damit bezwecken zu wollen. An anderer Stelle macht sich jemand über den Hausstaub her, indem er diesen als Archiv des Hauses liest.
Während der Autor stets den Ermittlungsstand in Sachen Gespenster für sich selbst notiert, indem er alle denkbaren Kataloge durchstöbert, kristallisieren sich bereits die ersten Fach-Essays heraus und schmuggeln sich in den auf vage getrimmten Text.
Geister im Elisabethanischen Theater, der Filmregisseur Michael Glawogger, der schwäbische Romantiker Justinus Kerner, manche Hotels in Wien, sowie das Meisterwerk „Shining“ liefern feine Methoden, wie das Gespenstische im Verborgenen ans Tageslicht gefördert und gezähmt werden könnte.
Zwischendurch brechen sich Schlagzeilen aus dem Boulevard Bahn, wenn etwa der amerikanische „gute“ Präsident Biden von einer Geisterarmee spricht, die er irgendwohin zu entsenden gedenkt, um Geisterwaffen zu stoppen.
Verlässlich aufgefädelt als kostbare Geister-Schnur der Literatur kommen kleine Werkanalysen zum Vorschein. Ibsens Gespenster, Wolfgang Bauers Gespenster als Gegenmodell der Popkultur, die Gespenstersonate bei Strindberg oder der Film Ghostwriter erweisen sich als feste Marksteine durch den weitläufigen Gespenster-Parcours.
Zwischen Gespinst, Gespenstern und Geistern wird je nach Notwendigkeit der Quellen unterschiedlich eingegangen, wiewohl gerade das Weitläufige der Begriffe ein tragendes Element ist. Aus heiterem Himmel werden etwa Geister-Völker vorgestellt, die ein nicht genauer beschriebenes Gefühl evozieren und Verunsicherung erzeugen sollen.
Wie raffiniert es beim Anblick des Geisterhaften zugehen kann, zeigt eine Notiz aus der bulgarischen Stadt Russe, in der Elias Canetti geboren ist. Als Memorial hat man eine kleine Büste aufgestellt, die von überdimensionalen Ventilatoren angeblasen ist. Der Geist des Meisters der Blendung soll offensichtlich quer durch die Jahreszeiten gekühlt werden. (162)
Das bedrohliche Brummen der leeren Minibar als Grundgeräusch für das Wirken der Gespenster wird am Ende noch einmal aufgegriffen und verfeinert. „[So klingen Gespenster] // Das Klagen des Kastens / Das Schlagen der Türen / Das Heulen des Fensters / Das Seufzen des Vorhangs / Das Rascheln / Das Rauschen / Das Strömen des Betts“ (213)
Wem das zu wenig genau ist, der sei auf die abschließende Namensliste verwiesen. Wie im Abspann zu einem Geisterfilm sind alle Namen alphabetisch aufgeführt, die im Buch einen gespenstischen Auftritt haben. (221)
Lucas Cejpek, Du siehst Gespenster und nichts in der Minibar
Wien: Sonderzahl Verlag 2024, 225 Seiten, 25,00 €, ISBN 978-3-85449-660-1
Weiterführende Links:
Sonderzahl Verlag: Lucas Cejpek, Du siehst Gespenster und nichts in der Minibar
Wikipedia: Lucas Cejpek
Helmuth Schönauer, 22-08-2024
