Klaus Merz, Unerwarteter Verlauf
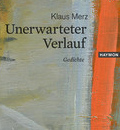 Die Geschwindigkeit, mit der ein Ereignis abläuft, hat nichts mit seiner Erwartbarkeit zu tun. So können uns spitze Dinge genauso unerwartet anspringen wie wir über den unheimlichen Verlauf eines langen Vorgangs überrascht sind.
Die Geschwindigkeit, mit der ein Ereignis abläuft, hat nichts mit seiner Erwartbarkeit zu tun. So können uns spitze Dinge genauso unerwartet anspringen wie wir über den unheimlichen Verlauf eines langen Vorgangs überrascht sind.
Klaus Merz setzt mit seinen Gedichten Nadelstiche in den Alltag, dadurch lässt er an manchen Tagen aufgestauten Überdruck ab, während er anderntags dem allmählichen Ablauf und Verrinnen der Zeit eine höhere Struktur zufügt.

 Der hundertste Geburtstag von Dichterinnen und Dichter ist für zeitlose Leser immer ein willkommener Anlass, deren Werk in der aktuellen Verankerung zu überprüfen durch Nachlesen.
Der hundertste Geburtstag von Dichterinnen und Dichter ist für zeitlose Leser immer ein willkommener Anlass, deren Werk in der aktuellen Verankerung zu überprüfen durch Nachlesen. Der Typenschein der „Flugblätter“ sagt es sehr genau: Lyrik kommt an gelungenen Tagen im Flug daher, Gedichte strömen durch die Zeit schwerelos wie die berüchtigten Blätter im Herbst, und eine politische Komponente darf im Zeitalter der Apps ebenfalls angenommen werden, Lyrik bringt zwischendurch auch Botschaften, die früher einmal im Zeitalter einer haptischen Öffentlichkeit über Flugblätter verbreitet worden ist.
Der Typenschein der „Flugblätter“ sagt es sehr genau: Lyrik kommt an gelungenen Tagen im Flug daher, Gedichte strömen durch die Zeit schwerelos wie die berüchtigten Blätter im Herbst, und eine politische Komponente darf im Zeitalter der Apps ebenfalls angenommen werden, Lyrik bringt zwischendurch auch Botschaften, die früher einmal im Zeitalter einer haptischen Öffentlichkeit über Flugblätter verbreitet worden ist. Manchmal nimmt einen die Lyrik gleich mehrfach bei der Hand und verführt einen auf der Hinterseite der Begriffe, an der Unterseite der Überschrift oder einfach an einem Ort außerhalb der Zeit.
Manchmal nimmt einen die Lyrik gleich mehrfach bei der Hand und verführt einen auf der Hinterseite der Begriffe, an der Unterseite der Überschrift oder einfach an einem Ort außerhalb der Zeit. Manche Titel brechen einem schon beim puren Vor-sich-hin-Murmeln das Herz, weil sie es in einer brutalen Silbenfolge so richtig sagen. „Brechen-brach-gebrochen“ erinnert an ungute Situationen, wo jemand vielleicht die Sprache lernen muss, während sie ihm ein anderer einprügelt und dadurch das Rückgrat bricht.
Manche Titel brechen einem schon beim puren Vor-sich-hin-Murmeln das Herz, weil sie es in einer brutalen Silbenfolge so richtig sagen. „Brechen-brach-gebrochen“ erinnert an ungute Situationen, wo jemand vielleicht die Sprache lernen muss, während sie ihm ein anderer einprügelt und dadurch das Rückgrat bricht. In ihren vagen Ausmaßen ist die Schattenzeit etwas, was sich über Herbst und Winter erstrecken kann, im Lebenslauf ist die Schattenzeit eine breite Linie, an der wie bei Joseph Conrad das Bewusstsein in einen anderen Zustand umschlägt.
In ihren vagen Ausmaßen ist die Schattenzeit etwas, was sich über Herbst und Winter erstrecken kann, im Lebenslauf ist die Schattenzeit eine breite Linie, an der wie bei Joseph Conrad das Bewusstsein in einen anderen Zustand umschlägt.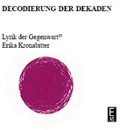 Lyrik hat immer mit Rätseln, Fragestellungen und Geheimsprachen zu tun, die Decodierung einer gestellten Aufgabe ist somit oft ein poetischer Vorgang.
Lyrik hat immer mit Rätseln, Fragestellungen und Geheimsprachen zu tun, die Decodierung einer gestellten Aufgabe ist somit oft ein poetischer Vorgang. Kluge Poesie ist alltagstauglich und grenzenlos, man weiß bei ihr nie, wo sie beginnt und wo sie aufhört.
Kluge Poesie ist alltagstauglich und grenzenlos, man weiß bei ihr nie, wo sie beginnt und wo sie aufhört.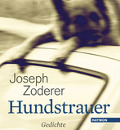 Die Hundstrauer ist so ein Wort, das man oft nachlässig hinsagt wie Hundswetter. Wenn sie aber Überbau für einen Gedichtband ist, steckt man als Leser gleich die Lauscher auf wie ein lyrischer Hund.
Die Hundstrauer ist so ein Wort, das man oft nachlässig hinsagt wie Hundswetter. Wenn sie aber Überbau für einen Gedichtband ist, steckt man als Leser gleich die Lauscher auf wie ein lyrischer Hund. Es sind manchmal diese schiefrig-aufmüpfigen Sätze, die einem sofort vor Augen führen, dass hier jemand die Sache des Schreibens ernst nimmt und dran bleiben wird: „ich bin so traurig, ich könnte / schreiben.“ (39)
Es sind manchmal diese schiefrig-aufmüpfigen Sätze, die einem sofort vor Augen führen, dass hier jemand die Sache des Schreibens ernst nimmt und dran bleiben wird: „ich bin so traurig, ich könnte / schreiben.“ (39)