Regina Dürig, Federn lassen
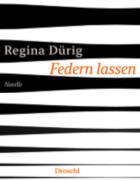 Während die einzelne Feder als etwas Edles gilt, immerhin verdanken wir dem Federkiel einen Großteil unserer Schriften, gilt der Vorgang für ihre Gewinnung als etwas Brutales. Das Federvieh entgeht dabei oft knapp einem Räuber, indem es Federn lässt. Ähnliches trägt sich in der Erziehung eines Individuums zu. In regelmäßigen Abständen muss es etwas von seiner Identität abwerfen, damit es von den Zugriffen der Gesellschaft halbwegs ungeschoren davonkommt.
Während die einzelne Feder als etwas Edles gilt, immerhin verdanken wir dem Federkiel einen Großteil unserer Schriften, gilt der Vorgang für ihre Gewinnung als etwas Brutales. Das Federvieh entgeht dabei oft knapp einem Räuber, indem es Federn lässt. Ähnliches trägt sich in der Erziehung eines Individuums zu. In regelmäßigen Abständen muss es etwas von seiner Identität abwerfen, damit es von den Zugriffen der Gesellschaft halbwegs ungeschoren davonkommt.
Regina Dürig überrascht noch vor Beginn der Lektüre mit zwei Besonderheiten: Einmal ist es die Verwendung des Genres Novelle, und zum anderen das spitze Hochformat des Buches, das als langer Schaft einer Feder ausgeführt ist. Durch dieses Layout ist der Text zu einem gedanklichen Longdrink verformt, in einer Zeile stehen kaum mehr als drei Wörter. Man beginnt daher automatisch mit dem Scrollen, obwohl es am Papier aussichtslos ist, dass dadurch der Text weiterginge. Die einzelnen Zeilen sind offensichtlich als Federäste gedacht, die ineinander verkeilt dann erst die Federfahne ergeben. Und der Ausdruck Novelle weist darauf hin, dass alle Zeilen zusammen gebündelt eine „unerhörte Begebenheit“ ausmachen, die ja das Wesen einer Novelle ist.

 „Das „Lehrbuch Literaturpädagogik“ ist ein Lernbegleiter, der die ganze Vielfalt dieses Tätigkeitsbereichs abdeckt. Es umreißt und erläutert die Handlungsfelder der Literaturpädagogik, formuliert Grundlagen für das pädagogische Handeln und gibt eine Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur.“ (S. 9f)
„Das „Lehrbuch Literaturpädagogik“ ist ein Lernbegleiter, der die ganze Vielfalt dieses Tätigkeitsbereichs abdeckt. Es umreißt und erläutert die Handlungsfelder der Literaturpädagogik, formuliert Grundlagen für das pädagogische Handeln und gibt eine Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur.“ (S. 9f)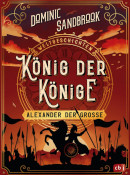 „Auf seinem Schiff brach Jubel aus, dann sprangen Tausende seiner Männer über Bord, um ihrem König auf persischen Boden zu folgen. Der junge Mann hieß Alexandros, was in etwa »Beschützer der Männer« bedeutet, und lebte vor über zweitausend Jahren, im vierten Jahrhundert vor Christus.“ (S. 8f)
„Auf seinem Schiff brach Jubel aus, dann sprangen Tausende seiner Männer über Bord, um ihrem König auf persischen Boden zu folgen. Der junge Mann hieß Alexandros, was in etwa »Beschützer der Männer« bedeutet, und lebte vor über zweitausend Jahren, im vierten Jahrhundert vor Christus.“ (S. 8f)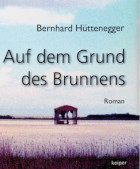 In alten Märchenbildern ist die Welt wie eine Sanduhr aus Sternen aufgebaut. Wer in die Tiefe eines Brunnens blickt, sieht darin die Sterne des Firmaments gespiegelt, wer in den Himmel schaut, wird in die Tiefe hinabgezogen wie in einen Brunnen.
In alten Märchenbildern ist die Welt wie eine Sanduhr aus Sternen aufgebaut. Wer in die Tiefe eines Brunnens blickt, sieht darin die Sterne des Firmaments gespiegelt, wer in den Himmel schaut, wird in die Tiefe hinabgezogen wie in einen Brunnen.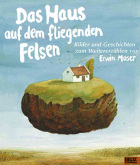 „Als Kind war ich sehr fasziniert von Bildern aller Art. Alles Gedruckte und Gemalte hat mich stark angezogen. Ein Bild zu betrachten bedeutete in das Bild hineinzusteigen. Die Umgebung ganz zu vergessen und richtig im Bild spazieren zu gehen. Was für ein Genuss!“
„Als Kind war ich sehr fasziniert von Bildern aller Art. Alles Gedruckte und Gemalte hat mich stark angezogen. Ein Bild zu betrachten bedeutete in das Bild hineinzusteigen. Die Umgebung ganz zu vergessen und richtig im Bild spazieren zu gehen. Was für ein Genuss!“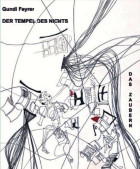 Wenn Materie nicht aus Materie besteht, wie in Physikerkreisen formuliert wird, dann könnte vielleicht Dichtung Materie sein?
Wenn Materie nicht aus Materie besteht, wie in Physikerkreisen formuliert wird, dann könnte vielleicht Dichtung Materie sein?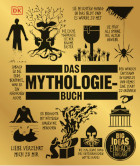 „Mythen sind das Feld der poetischen Imagination und doch so viel mehr als nur Geschichten. Auch heute noch bieten Mythen Menschen auf der ganzen Welt Orientierung, denn sie handeln von den großen Geheimnissen, die uns alle faszinieren: von Geburt und Tod und der menschlichen Existenz.“ (S. 13)
„Mythen sind das Feld der poetischen Imagination und doch so viel mehr als nur Geschichten. Auch heute noch bieten Mythen Menschen auf der ganzen Welt Orientierung, denn sie handeln von den großen Geheimnissen, die uns alle faszinieren: von Geburt und Tod und der menschlichen Existenz.“ (S. 13)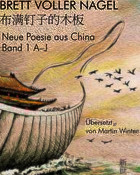 Wenn dir beim Aufschlagen eines Buches alles fremd ist, lies es wie ein Lexikon!
Wenn dir beim Aufschlagen eines Buches alles fremd ist, lies es wie ein Lexikon!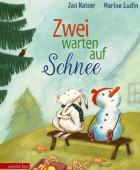 „Schorsch und Holm hatten auch ein kleines, gemütliches Häuschen auf einem Hügel, in dem sie gemeinsam wohnten. Und einen kleinen Garten mit einem Tannenbaum, den sie weihnachtlich schmücken wollten. Denn bald war Weihnachten …“
„Schorsch und Holm hatten auch ein kleines, gemütliches Häuschen auf einem Hügel, in dem sie gemeinsam wohnten. Und einen kleinen Garten mit einem Tannenbaum, den sie weihnachtlich schmücken wollten. Denn bald war Weihnachten …“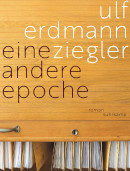 Staatstragende Romane sollten wenigstens zehn Jahre lang warten, ehe sie eine Gegenwart historisch abgekühlte beschreiben. Alles, was zu nahe an den aktuellen Kalender herangeführt ist, klingt nach Wahlkampf, Propaganda oder Streitschrift.
Staatstragende Romane sollten wenigstens zehn Jahre lang warten, ehe sie eine Gegenwart historisch abgekühlte beschreiben. Alles, was zu nahe an den aktuellen Kalender herangeführt ist, klingt nach Wahlkampf, Propaganda oder Streitschrift.