Olaf B. Rader, Kaiser Karl der Vierte - Das Beben der Welt
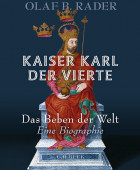 „Von Auserwähltheit geradezu «durchtränkt»: so möchte ich das Leben Karls in diesem Buch deuten und beschreiben. Seine Überzeugung, auserwählt zu sein, bedeutete ja nicht, dass sich der Monarch als passives Werkzeug des Herrn sah und sich in seinen Handlungen eigener Entscheidungen enthoben glaubte, sondern im Gegenteil, dass er mit seinen Fähigkeiten dem Willen Gottes Geltung verschaffen wollte, soweit es in seinen Kräften stand.“ (S. 20)
„Von Auserwähltheit geradezu «durchtränkt»: so möchte ich das Leben Karls in diesem Buch deuten und beschreiben. Seine Überzeugung, auserwählt zu sein, bedeutete ja nicht, dass sich der Monarch als passives Werkzeug des Herrn sah und sich in seinen Handlungen eigener Entscheidungen enthoben glaubte, sondern im Gegenteil, dass er mit seinen Fähigkeiten dem Willen Gottes Geltung verschaffen wollte, soweit es in seinen Kräften stand.“ (S. 20)
Karl IV. gilt als ebenso widersprüchliche wie eindrucksvolle Figur auf dem Thron des römisch-deutschen Kaisers im Spätmittelalter. Im ambivalenten Urteil der Geschichtsschreibung der Gegenwart liegen seine Mittel zur Durchsetzung seiner politischen Ziele zwischen dem wiederbeleben alter und bewährter Praktiken und neuen, in die Zukunft weisenden Methoden.

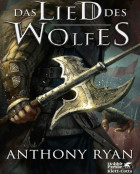 „Heutzutage nennen viele meinen Bruder ein Ungeheuer. Seine Taten, die schrecklichen wie die wundersamen, sind für sie das Werk eines übernatürlichen Wesens, das die Gestalt eines Menschen annahm, um furchtbares Unheil über uns alle zu bringen. In den dunklen und elenden Ecken der Welt wird er von manchen noch als Gott bezeichnet, aber das nur in furchtsamem Flüsterton. Interessanterweise sprechen weder Erstere noch Letztere seinen wahren Namen aus, dabei kennen sie ihn so gut wie ich.“ (S. 15)
„Heutzutage nennen viele meinen Bruder ein Ungeheuer. Seine Taten, die schrecklichen wie die wundersamen, sind für sie das Werk eines übernatürlichen Wesens, das die Gestalt eines Menschen annahm, um furchtbares Unheil über uns alle zu bringen. In den dunklen und elenden Ecken der Welt wird er von manchen noch als Gott bezeichnet, aber das nur in furchtsamem Flüsterton. Interessanterweise sprechen weder Erstere noch Letztere seinen wahren Namen aus, dabei kennen sie ihn so gut wie ich.“ (S. 15) Während man bei einem Roman davon ausgeht, dass er zum Augenblick seiner Vollendung mit Ort und Zeit als Quelldaten fixiert wird, zeigen sich Erzählbände oft als Bunter Text-Kessel, der an mannigfaltigen Orten aufgekocht und über Jahrzehnte eingedickt worden ist.
Während man bei einem Roman davon ausgeht, dass er zum Augenblick seiner Vollendung mit Ort und Zeit als Quelldaten fixiert wird, zeigen sich Erzählbände oft als Bunter Text-Kessel, der an mannigfaltigen Orten aufgekocht und über Jahrzehnte eingedickt worden ist.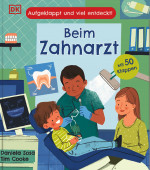 „Du brauchst deine Zähne immer beim Essen. Kümmere dich daher gut um sie. Ein Zahnarzt kann dir helfen, deine Zähne zu pflegen. Du solltest alle sechs Monate zur Kontrolluntersuchung gehen. Hier macht Papa einen Termin für die ganze Familie aus.“
„Du brauchst deine Zähne immer beim Essen. Kümmere dich daher gut um sie. Ein Zahnarzt kann dir helfen, deine Zähne zu pflegen. Du solltest alle sechs Monate zur Kontrolluntersuchung gehen. Hier macht Papa einen Termin für die ganze Familie aus.“ pätestens seit Daniel Defoe gilt ein entlegenes Eiland als ideale Erzählfläche, um darauf Lebens- und Weltentwürfe spielen zu lassen. Wenn diese Insel dann noch einer definitiven Zeit entrückt wird, indem quasi jede Zeit auf der Insel Platz hat, dann erweist sich die „Zeitinsel“ als höchst verdichtetes Material, das astrophysikalisch vielleicht an ein schwarzes Loch herankommt.
pätestens seit Daniel Defoe gilt ein entlegenes Eiland als ideale Erzählfläche, um darauf Lebens- und Weltentwürfe spielen zu lassen. Wenn diese Insel dann noch einer definitiven Zeit entrückt wird, indem quasi jede Zeit auf der Insel Platz hat, dann erweist sich die „Zeitinsel“ als höchst verdichtetes Material, das astrophysikalisch vielleicht an ein schwarzes Loch herankommt.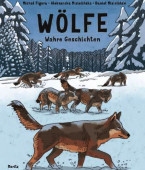 „Dieses Buch erzählt wahre Geschichten über Wölfe – zum Beispiel über Szelina, Luna, Kampinos, Jung oder Miko. Erzählt werden sie von Michal Figura, der seit 20 Jahren Wölfe und Luchse aufspürt und zu ihnen forscht. Die Wolfsfamilien von Grapa und Halna, von denen ihr hier lesen werdet, leben gleich hinter seinem Haus. Wir haben versucht, seine Geschichten so getreu wie möglich wiederzugeben.“ (S. 4)
„Dieses Buch erzählt wahre Geschichten über Wölfe – zum Beispiel über Szelina, Luna, Kampinos, Jung oder Miko. Erzählt werden sie von Michal Figura, der seit 20 Jahren Wölfe und Luchse aufspürt und zu ihnen forscht. Die Wolfsfamilien von Grapa und Halna, von denen ihr hier lesen werdet, leben gleich hinter seinem Haus. Wir haben versucht, seine Geschichten so getreu wie möglich wiederzugeben.“ (S. 4)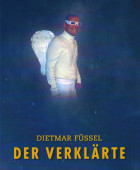 In Denksphären mit mannigfaltigen Spielregeln sind die verwendeten Begriffe oft labil wie Quanten, sie können zu Beginn eines Satzes etwas anderes bedeuten als an dessen Ende. Vor allem Theologie und Literatur werden diesem Metier zugerechnet, dessen Protagonisten oft als Schwurbler auftreten. Die Sprache hält für diese Geschichten exquisite Begriffe parat, die wie Leitpflöcke den Diskurs durch den Nebel führen. – „Der Verklärte“ ist so ein Begriff.
In Denksphären mit mannigfaltigen Spielregeln sind die verwendeten Begriffe oft labil wie Quanten, sie können zu Beginn eines Satzes etwas anderes bedeuten als an dessen Ende. Vor allem Theologie und Literatur werden diesem Metier zugerechnet, dessen Protagonisten oft als Schwurbler auftreten. Die Sprache hält für diese Geschichten exquisite Begriffe parat, die wie Leitpflöcke den Diskurs durch den Nebel führen. – „Der Verklärte“ ist so ein Begriff.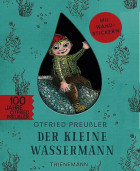 „Als der Wassermann eines Tages nach Hause kam, sagte die Wassermannfrau zu ihm: »Heute musst du ganz leise sein. Wir haben nämlich einen kleinen Jungen bekommen.« »Was du nicht sagst!«, rief der Wassermann voller Freude. »Einen richtigen Jungen?« »Ja, einen richtigen kleinen Wassermann«, sagte die Frau.“ (S. 9 f)
„Als der Wassermann eines Tages nach Hause kam, sagte die Wassermannfrau zu ihm: »Heute musst du ganz leise sein. Wir haben nämlich einen kleinen Jungen bekommen.« »Was du nicht sagst!«, rief der Wassermann voller Freude. »Einen richtigen Jungen?« »Ja, einen richtigen kleinen Wassermann«, sagte die Frau.“ (S. 9 f)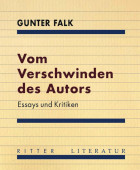 In einem funktionalen Lehrbild werden literarische Aufsätze manchmal als Bodenmarkierungen gelesen, die den Verkehrsstrom der Literatur regeln und entflechten sollen. Wie bei echten Bodenmarkierungen verlieren die literarischen oft ihren Sinn, wenn die entsprechende Gegenwart vorbei ist. Aufsätze aus verflossenen Zeiten gleichen dann grobkörnigen Linien auf Asphaltfragmenten, die schon längst von Pionierpflanzen umkreist sind.
In einem funktionalen Lehrbild werden literarische Aufsätze manchmal als Bodenmarkierungen gelesen, die den Verkehrsstrom der Literatur regeln und entflechten sollen. Wie bei echten Bodenmarkierungen verlieren die literarischen oft ihren Sinn, wenn die entsprechende Gegenwart vorbei ist. Aufsätze aus verflossenen Zeiten gleichen dann grobkörnigen Linien auf Asphaltfragmenten, die schon längst von Pionierpflanzen umkreist sind. „Dieses Buch hat eine Gebrauchsanweisung, weil es nicht im üblichen Sinn gelesen, sondern benutzt werden will. Es ist ein Philosophiebuch, aber keine philosophische Abhandlung. Es ist auch kein Lehrbuch, was aber nicht heißt, dass man nichts mitnehmen und lernen kann. Doch das Menü muss man sich selbst zusammenstellen. Die Menükarte ist ein Angebot zum Self-Service.“ (S. 9)
„Dieses Buch hat eine Gebrauchsanweisung, weil es nicht im üblichen Sinn gelesen, sondern benutzt werden will. Es ist ein Philosophiebuch, aber keine philosophische Abhandlung. Es ist auch kein Lehrbuch, was aber nicht heißt, dass man nichts mitnehmen und lernen kann. Doch das Menü muss man sich selbst zusammenstellen. Die Menükarte ist ein Angebot zum Self-Service.“ (S. 9)