Julie Leuze, Hier kommt Kalli Wüstenmucks
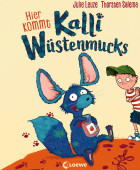 „Leo blinzelt. Was zur Hölle ist das? Es sieht aus wie ein kleiner Fuchs. Mit riesengroßen Ohren. Mit einem flauschigen Fell, das tatsächlich ganz herrlich anzusehen ist. Der Körper des Tieres schimmert in einem tiefen Dunkelblau und hat lustige grasgrüne Flecken. Die Ohren, die Schnauze und die buschige Schwanzspitze dagegen sind leuchtend türkis. Leo schüttelt den Kopf. Ein bunter großohriger Fuchs, der sprechen kann?!“ (S. 28)
„Leo blinzelt. Was zur Hölle ist das? Es sieht aus wie ein kleiner Fuchs. Mit riesengroßen Ohren. Mit einem flauschigen Fell, das tatsächlich ganz herrlich anzusehen ist. Der Körper des Tieres schimmert in einem tiefen Dunkelblau und hat lustige grasgrüne Flecken. Die Ohren, die Schnauze und die buschige Schwanzspitze dagegen sind leuchtend türkis. Leo schüttelt den Kopf. Ein bunter großohriger Fuchs, der sprechen kann?!“ (S. 28)
Leo liebt die Tiere, was nicht ganz überrascht, arbeitet seine Mutter doch in einer Tierpraxis und in einer Wildtierstation, die von seinem Vater geleitet wird. Als er eines Tages beschließt in der Tierstation zu helfen, erlebte er mit Jenny der Tierpfleger ein riesiges Chaos im Futterhaus. Die Futtervorräte liegen ganz wild durcheinander und niemand weiß, wer für die Unordnung verantwortlich ist.

 Werkzeuge lassen sich in zwei Richtungen hin einsetzen, einmal, um einen bestimmten Sachverhalt zu erkunden, zu korrigieren oder zu optimieren, und im umgekehrten Sinn, indem man schaut, wofür sich dieses Werkzeug zusätzlich verwenden ließe.
Werkzeuge lassen sich in zwei Richtungen hin einsetzen, einmal, um einen bestimmten Sachverhalt zu erkunden, zu korrigieren oder zu optimieren, und im umgekehrten Sinn, indem man schaut, wofür sich dieses Werkzeug zusätzlich verwenden ließe.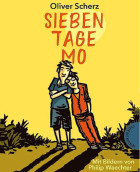 „Ich hielt an, wischte mir den Schweiß aus dem Gesicht und schaute gebannt auf die schwarz-graue Wolkenwand. Da ahnte ich noch nicht, wie sehr mich die nächsten Tage durcheinanderbringen würden. Dass es mir vorkommen sollte, als würde mich ein Wirbelwind in die Luft drehen, bis ich mich selbst nicht mehr richtig verstand …“ (S. 24)
„Ich hielt an, wischte mir den Schweiß aus dem Gesicht und schaute gebannt auf die schwarz-graue Wolkenwand. Da ahnte ich noch nicht, wie sehr mich die nächsten Tage durcheinanderbringen würden. Dass es mir vorkommen sollte, als würde mich ein Wirbelwind in die Luft drehen, bis ich mich selbst nicht mehr richtig verstand …“ (S. 24) „Immanuel Kant ist der bedeutendste Philosoph der Neuzeit, die Kritik der reinen Vernunft ein Meilenstein der Geistesgeschichte. Seit Platon und Aristoteles hat niemand über so viele und unterschiedliche Themen tiefer und innovativer nachgedacht als Kant. Er «zermalmte» die traditionelle Metaphysik – und begründete eine neue. Er erklärte die Entstehung unseres Planetensystems und formulierte den kategorischen Imperativ. Er war Wegbereiter des Kosmopolitismus und der modernen Idee der Menschenwürde.“ (S. 13)
„Immanuel Kant ist der bedeutendste Philosoph der Neuzeit, die Kritik der reinen Vernunft ein Meilenstein der Geistesgeschichte. Seit Platon und Aristoteles hat niemand über so viele und unterschiedliche Themen tiefer und innovativer nachgedacht als Kant. Er «zermalmte» die traditionelle Metaphysik – und begründete eine neue. Er erklärte die Entstehung unseres Planetensystems und formulierte den kategorischen Imperativ. Er war Wegbereiter des Kosmopolitismus und der modernen Idee der Menschenwürde.“ (S. 13)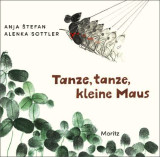 „Trilli lilli, trallala, / unser Mäuschen ist nicht da, /Wo ist es? Am Hügel drüben, / such nach großen roten Rüben. // Trilli lilli, trallala wann ist Mäuschen wieder da? / Das weiß keiner, denn beim Gehen / bleibt’s bei jeder Blume stehen.“
„Trilli lilli, trallala, / unser Mäuschen ist nicht da, /Wo ist es? Am Hügel drüben, / such nach großen roten Rüben. // Trilli lilli, trallala wann ist Mäuschen wieder da? / Das weiß keiner, denn beim Gehen / bleibt’s bei jeder Blume stehen.“ Historische Zeitepochen werden oft nach psychischen Klein-Befindlichkeiten benannt, ehe sich dann ein großer Begriff durchsetzt wie beim Barock oder der Romantik. Um 1900 wurde etwa vom „nervösen Zeitalter“ gesprochen, weil der Erste Weltkrieg ja noch auf sich warten ließ. Die Gegenwart hat ebenfalls viele Probe-Begriffe im Umlauf. Unter anderem verwendet sie den Ausdruck „Wutbürger“, um den Auflauf irritierter Menschen zu beschreiben.
Historische Zeitepochen werden oft nach psychischen Klein-Befindlichkeiten benannt, ehe sich dann ein großer Begriff durchsetzt wie beim Barock oder der Romantik. Um 1900 wurde etwa vom „nervösen Zeitalter“ gesprochen, weil der Erste Weltkrieg ja noch auf sich warten ließ. Die Gegenwart hat ebenfalls viele Probe-Begriffe im Umlauf. Unter anderem verwendet sie den Ausdruck „Wutbürger“, um den Auflauf irritierter Menschen zu beschreiben.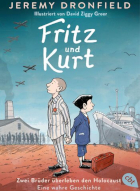 „Ich erzähle die Geschichte einer Familie, die mehr Grund zur Sorge hatte als viele andere. Sie hieß Kleinmann. Gustav und seine Frau Tini hatten vier Kinder: zwei Mädchen und zwei Jungen – Edith und Herta, Fritz und Kurt. Sie lebten in Wien, der schönen alten Hauptstadt von Österreich. (S. 16)
„Ich erzähle die Geschichte einer Familie, die mehr Grund zur Sorge hatte als viele andere. Sie hieß Kleinmann. Gustav und seine Frau Tini hatten vier Kinder: zwei Mädchen und zwei Jungen – Edith und Herta, Fritz und Kurt. Sie lebten in Wien, der schönen alten Hauptstadt von Österreich. (S. 16) In manchen Kulturen wird das Parterre eines Gebäudes mit „Plattform eins“ bezeichnet. Das trifft sich gut, denn unter Parterre versteht man im psychologischen Kontext einen Zustand, bei dem die Helden seltsam am Boden sind. – „Heute bin ich wieder ganz Parterre!“
In manchen Kulturen wird das Parterre eines Gebäudes mit „Plattform eins“ bezeichnet. Das trifft sich gut, denn unter Parterre versteht man im psychologischen Kontext einen Zustand, bei dem die Helden seltsam am Boden sind. – „Heute bin ich wieder ganz Parterre!“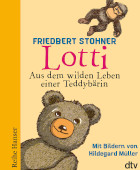 Also es war an einem Montag, da durften wir unser Lieblingskuscheltier mit in die Schule bringen, und ich hab Lotti mitgenommen, und als ich nach Hause kam, war sie nicht mehr in meinem Rucksack, sondern bloß Nikos blöder Gorilla, der angeblich dauernd pupsen musste, dabei war es bloß Niko selber mit den Lippen. So ist mein Teddy Lotti verschwunden … (S. 5)
Also es war an einem Montag, da durften wir unser Lieblingskuscheltier mit in die Schule bringen, und ich hab Lotti mitgenommen, und als ich nach Hause kam, war sie nicht mehr in meinem Rucksack, sondern bloß Nikos blöder Gorilla, der angeblich dauernd pupsen musste, dabei war es bloß Niko selber mit den Lippen. So ist mein Teddy Lotti verschwunden … (S. 5)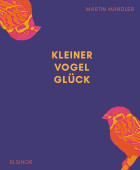 Wenn die Vögel aussterben, erfahren Romane mit dem Wort Vogel im Titel umso heftigere Aufmerksamkeit.
Wenn die Vögel aussterben, erfahren Romane mit dem Wort Vogel im Titel umso heftigere Aufmerksamkeit.