 Bildung entsteht letztlich dadurch, dass man sich als Individuum eine persönliche App in seine Psyche herunterlädt, die einem immer erklärt, was man zu tun hat.
Bildung entsteht letztlich dadurch, dass man sich als Individuum eine persönliche App in seine Psyche herunterlädt, die einem immer erklärt, was man zu tun hat.
Reinhilde Feichter lässt ihre Heldin Emeli Knolleisen so lange im Leben auflaufen, bis sie kapiert, wie es geht. Die Ich-Erzählerin geht dabei recht selbstbewusst vor, wenn es um sie selbst geht, schon die Geburt als Frühchen wird ein Abenteuer, bei dem Emeli als Siegerin hervortritt.

 Immer wieder machen sich in der Malerei Sequenzen selbständig und werden zur Literatur. Aus Bildbeschreibungen, Paint-Journalen oder Katalogvorgaben nehmen zwischendurch Texte Reißaus und flüchten in einen eigenen Erzählband, der dann vielleicht „Bunte Geschichten“ heißt.
Immer wieder machen sich in der Malerei Sequenzen selbständig und werden zur Literatur. Aus Bildbeschreibungen, Paint-Journalen oder Katalogvorgaben nehmen zwischendurch Texte Reißaus und flüchten in einen eigenen Erzählband, der dann vielleicht „Bunte Geschichten“ heißt. Polaroids im klassischen Sinne sind Fotos, die ohne den Umweg über ein Labor oder einen Computer beinahe in Echtzeit aus dem Fotoapparat gespuckt werden, nachdem man abgedrückt hat.
Polaroids im klassischen Sinne sind Fotos, die ohne den Umweg über ein Labor oder einen Computer beinahe in Echtzeit aus dem Fotoapparat gespuckt werden, nachdem man abgedrückt hat. Unheimlich lautlos friert den Enten der Teich zu – in der Lyrik geschieht das Ungeheure tatsächlich lautlos, wie in einem Horrorfilm wird der Leser bei seinen Emotionen gepackt, gefesselt und vom Rand her eingefroren.
Unheimlich lautlos friert den Enten der Teich zu – in der Lyrik geschieht das Ungeheure tatsächlich lautlos, wie in einem Horrorfilm wird der Leser bei seinen Emotionen gepackt, gefesselt und vom Rand her eingefroren. Wenn die richtigen Typen zusammenkommen, entsteht durchaus freche Lyrik. Wenn zwergenhafte Schatzhüter (Gnomen) und Doppeltreffer im Lotto (Amben) aufeinandertreffen, kann eigentlich nur die Lyrik des Oswald Egger daraus entstehen.
Wenn die richtigen Typen zusammenkommen, entsteht durchaus freche Lyrik. Wenn zwergenhafte Schatzhüter (Gnomen) und Doppeltreffer im Lotto (Amben) aufeinandertreffen, kann eigentlich nur die Lyrik des Oswald Egger daraus entstehen. Regionale Krimis summen in erster Linie einmal die Vorzüge der Geschichte wie eine Hymne ab, ehe sich darin kurz das regionale Böse zeigt, das selbstverständlich von den Guten in die Schranken verwiesen wird.
Regionale Krimis summen in erster Linie einmal die Vorzüge der Geschichte wie eine Hymne ab, ehe sich darin kurz das regionale Böse zeigt, das selbstverständlich von den Guten in die Schranken verwiesen wird. Müde Schülerinnen, Lehrerinnen und Bibliothekarinnen träumen davon, dass sie etwas gelesen haben, ehe sie eingeschlafen sind, ohne dass sie etwas gelesen haben.
Müde Schülerinnen, Lehrerinnen und Bibliothekarinnen träumen davon, dass sie etwas gelesen haben, ehe sie eingeschlafen sind, ohne dass sie etwas gelesen haben. Die Regionalgeschichte wirkt umso verlorener, je weiter zurück sie in der Dunkelheit liegt. Wenn eine Gegend nicht eine saftige Schlacht oder ein paar einäugige Helden aufweist, tut sie sich verdammt hart, eine unsterbliche Bedeutung für die Geschäfte der Gegenwart nachzuweisen.
Die Regionalgeschichte wirkt umso verlorener, je weiter zurück sie in der Dunkelheit liegt. Wenn eine Gegend nicht eine saftige Schlacht oder ein paar einäugige Helden aufweist, tut sie sich verdammt hart, eine unsterbliche Bedeutung für die Geschäfte der Gegenwart nachzuweisen. Im Bereich der inneren Sicherheit der Wiener Szenerie gibt es allgemein nur schwere Fälle, die von einem schwerfälligen Beamtenapparat nur mühsam abgearbeitet werden können.
Im Bereich der inneren Sicherheit der Wiener Szenerie gibt es allgemein nur schwere Fälle, die von einem schwerfälligen Beamtenapparat nur mühsam abgearbeitet werden können.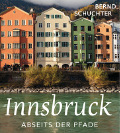 Gerade in Zeiten der Apps und Maps braucht es zum Entschleunigen zwischendurch diesen guten alten „Führer“, in dem man sich innen über die eigene Reise orientieren kann und an dem außen am Verschleiß die anderen beurteilen können, wie intensiv man die Reise nimmt.
Gerade in Zeiten der Apps und Maps braucht es zum Entschleunigen zwischendurch diesen guten alten „Führer“, in dem man sich innen über die eigene Reise orientieren kann und an dem außen am Verschleiß die anderen beurteilen können, wie intensiv man die Reise nimmt.