Dine Petrik, Funken. Klagen
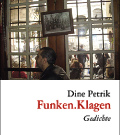 In der Lyrik ist nichts selbstverständlich, wenn man glaubt, eine Fügung würde etwas genau beschreiben, so liegt daneben eine noch genauere, die es noch genauer sagt.
In der Lyrik ist nichts selbstverständlich, wenn man glaubt, eine Fügung würde etwas genau beschreiben, so liegt daneben eine noch genauere, die es noch genauer sagt.
Dine Petrik arbeitet in einem doppelten Veredelungsprozess. Zuerst wird der Stoff poetisiert, und dort, wo scheinbar schon die Gedichte fertig sind, kommen sie noch einmal ins Galvanisierungs-Bad und erhalten eine Zeit-feste Außenhaut. Wo man bereits mit Funken schlagen in die Gewissheit gelenkt wird, kommt eine neue Perspektive hinzu, der Titel der Gedichtsammlung heißt folglich richtig „Funken.

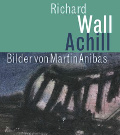 Ein heroischer Titel, Bilder von der unterirdischen Gewalt einer Kontinental-Drift, Gedichte ausgerichtet wie ein Flügelaltar, ein Nobelpreisträger auf den kargen Boden irdischer Lebenserfahrung zurückgeholt - so fühlt sich ein Gesamtkunstwerk aus den Händen von Richard Wall und Martin Anibas an.
Ein heroischer Titel, Bilder von der unterirdischen Gewalt einer Kontinental-Drift, Gedichte ausgerichtet wie ein Flügelaltar, ein Nobelpreisträger auf den kargen Boden irdischer Lebenserfahrung zurückgeholt - so fühlt sich ein Gesamtkunstwerk aus den Händen von Richard Wall und Martin Anibas an. Auch wenn der Kapitalismus noch so sehr darauf pocht, dass man die Welt besitzen könne, Landschaften jedenfalls lassen sich nicht besitzen, sondern nur leihen. Damit gleichen sie unseren besten Büchern in den Bibliotheken, deren Inhalt man zwar besitzen kann, wenn man ihn gelesen hat, deren Korpus aber nur geliehen ist.
Auch wenn der Kapitalismus noch so sehr darauf pocht, dass man die Welt besitzen könne, Landschaften jedenfalls lassen sich nicht besitzen, sondern nur leihen. Damit gleichen sie unseren besten Büchern in den Bibliotheken, deren Inhalt man zwar besitzen kann, wenn man ihn gelesen hat, deren Korpus aber nur geliehen ist.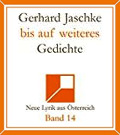 Die Lyrik fließt nicht nur als feierliches Brimborium, als spitze Spreche oder abgeklärter Lesebucheintrag durchs Land, die wilde Lyrik ist oft unauffällig, selbstkritisch und politisch in ihrer Verweigerung des tagespolitischen Geplänkels.
Die Lyrik fließt nicht nur als feierliches Brimborium, als spitze Spreche oder abgeklärter Lesebucheintrag durchs Land, die wilde Lyrik ist oft unauffällig, selbstkritisch und politisch in ihrer Verweigerung des tagespolitischen Geplänkels. In der Pionierphase des Poetry Slam waren die Auftritte der Künstler oft ein illuminierter Wutschrei, und die ersten Bücher darüber waren unlesbare Niederschriften leicht depressiver Monologisten. Mittlerweile ist Poetry Slam eine kontinental verbreitete literarische Giga-Form mit eigener Geschichte, mitreißenden Ritualen und ausgewiesenen Experten an Bord.
In der Pionierphase des Poetry Slam waren die Auftritte der Künstler oft ein illuminierter Wutschrei, und die ersten Bücher darüber waren unlesbare Niederschriften leicht depressiver Monologisten. Mittlerweile ist Poetry Slam eine kontinental verbreitete literarische Giga-Form mit eigener Geschichte, mitreißenden Ritualen und ausgewiesenen Experten an Bord.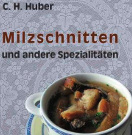 Jede gesellschaftliche Etage bringt zu gewissen Zeiten modische, kulinarische oder spielerische Gesten hervor, die eine Zeit recht gut beschreiben und hintennach als historisches Aha-Erlebnis gehandelt werden. Die Milzschnitten sind so eine Spezialität, die in diversen Haushalten des Wirtschaftswunders mit Genuss und Ekel verzehrt worden ist, ehe ihr hygienische EU-Vorschriften zumindest als Massenartikel den Garaus gemacht haben.
Jede gesellschaftliche Etage bringt zu gewissen Zeiten modische, kulinarische oder spielerische Gesten hervor, die eine Zeit recht gut beschreiben und hintennach als historisches Aha-Erlebnis gehandelt werden. Die Milzschnitten sind so eine Spezialität, die in diversen Haushalten des Wirtschaftswunders mit Genuss und Ekel verzehrt worden ist, ehe ihr hygienische EU-Vorschriften zumindest als Massenartikel den Garaus gemacht haben. Raffinierte Titel sind immer mehrdeutig wie die Lyrik überhaupt. Landaufnahmen können sich auf die Rezeption besinnen, wonach jemand Aufnahmen von einem Land macht und es als Kunstrichtung zwischen Selfie und Landschaftsmalerei ablegt. Die Landaufnahmen können sich aber auch auf die Gastfreundschaft eines Landes beziehen, wenn das Land jemanden willkommen heißt und aufnimmt.
Raffinierte Titel sind immer mehrdeutig wie die Lyrik überhaupt. Landaufnahmen können sich auf die Rezeption besinnen, wonach jemand Aufnahmen von einem Land macht und es als Kunstrichtung zwischen Selfie und Landschaftsmalerei ablegt. Die Landaufnahmen können sich aber auch auf die Gastfreundschaft eines Landes beziehen, wenn das Land jemanden willkommen heißt und aufnimmt. Wenn es einem Dichter gelingt, den archaischen Lebenskampf durch Saufen zu unterlegen und dabei noch Patriotismus zu entwickeln, steht einem flächendeckenden Absingen seiner Hymnen nichts mehr im Wege.
Wenn es einem Dichter gelingt, den archaischen Lebenskampf durch Saufen zu unterlegen und dabei noch Patriotismus zu entwickeln, steht einem flächendeckenden Absingen seiner Hymnen nichts mehr im Wege. Manchmal erzählt ein winziger Druckfehler eine ganze Geschichte der Hoffnung und Unsterblichkeit. Im Abschlusskommentar zum dritten Band „Das Gedächtnis der Wellen“ von Gerhard Kofler wird sein letztes Gedicht auf 24. August 2015 datiert, ein logischer Gedanke, denn niemand kann es noch glauben, dass der Autor 2005 gestorben ist.
Manchmal erzählt ein winziger Druckfehler eine ganze Geschichte der Hoffnung und Unsterblichkeit. Im Abschlusskommentar zum dritten Band „Das Gedächtnis der Wellen“ von Gerhard Kofler wird sein letztes Gedicht auf 24. August 2015 datiert, ein logischer Gedanke, denn niemand kann es noch glauben, dass der Autor 2005 gestorben ist. Im Volksmund wird das Geglotze, das sich die Helden an der Bar kurz vor dem Umsinken in das Antlitz schmieren, lyrischer Blick genannt. Feiner ausgedrückt handelt es sich dabei um „dies irre Geglitzer in deinem Blick“.
Im Volksmund wird das Geglotze, das sich die Helden an der Bar kurz vor dem Umsinken in das Antlitz schmieren, lyrischer Blick genannt. Feiner ausgedrückt handelt es sich dabei um „dies irre Geglitzer in deinem Blick“.