Sepp Mall, Schläft ein Lied
 Was bleibt an Nachbildern, wenn man schnell die Augen vor der Realität verschließt? - Es bleibt die Kindheit, der Acker, auf dem sich Pflanzen und Kinder tummeln, die Stube, die die Jahreszeiten hinaus sperrt, es bleiben zwei drei Schafe, die unvermittelt auf der Schreibtischplatte auftauchen.
Was bleibt an Nachbildern, wenn man schnell die Augen vor der Realität verschließt? - Es bleibt die Kindheit, der Acker, auf dem sich Pflanzen und Kinder tummeln, die Stube, die die Jahreszeiten hinaus sperrt, es bleiben zwei drei Schafe, die unvermittelt auf der Schreibtischplatte auftauchen.
Sepp Mall braucht wie ein genialer Musiker nur zwei drei Handgriffe, um mit unverwechselbaren Riffs seine Lyrik zum Klingen zu bringen.

 Das Druckwesen hat zur Entwicklung der Gesellschaft mindestens so viel beigetragen wie die Adelsgeschlechter zusammen, daher gebührt es einer guten Druckerei, dass sie zwischendurch epochal dargestellt wird.
Das Druckwesen hat zur Entwicklung der Gesellschaft mindestens so viel beigetragen wie die Adelsgeschlechter zusammen, daher gebührt es einer guten Druckerei, dass sie zwischendurch epochal dargestellt wird. Auf den ersten Blick besteht die Unsterblichkeit in Gebäuden, Galerien und Kreisverkehren. Was eine Gesellschaft im Laufe einer Generation zusammenbaut, beeindruckt auf Anhieb durch Architektur, Funktion und Verbrauch von Landschaft.
Auf den ersten Blick besteht die Unsterblichkeit in Gebäuden, Galerien und Kreisverkehren. Was eine Gesellschaft im Laufe einer Generation zusammenbaut, beeindruckt auf Anhieb durch Architektur, Funktion und Verbrauch von Landschaft. Halbsätze kommen den Lesern verführerisch entgegen, indem sie einladen, den Halbsatz zu vervollständigen nach Laune und Wissenstand.
Halbsätze kommen den Lesern verführerisch entgegen, indem sie einladen, den Halbsatz zu vervollständigen nach Laune und Wissenstand. Der Himalaya ist für uns Alpenmenschen an manchen Tagen etwas Vertrautes oder Mystisches, auf jeden Fall etwas Großes und Gigantisches. Diese Einschätzung hängt mit den Personen zusammen, die uns diese Himalaya-Geschichten vermitteln, mal sind es Abenteurer, dann religiöse Aussteiger, schließlich auch Performance-Künstler, die mit ihren Himalaya-Museen und Hochlandshows ihren Lebensunterhalt verdienen.
Der Himalaya ist für uns Alpenmenschen an manchen Tagen etwas Vertrautes oder Mystisches, auf jeden Fall etwas Großes und Gigantisches. Diese Einschätzung hängt mit den Personen zusammen, die uns diese Himalaya-Geschichten vermitteln, mal sind es Abenteurer, dann religiöse Aussteiger, schließlich auch Performance-Künstler, die mit ihren Himalaya-Museen und Hochlandshows ihren Lebensunterhalt verdienen.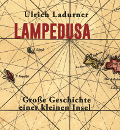 Eine Insel fordert die jeweilige Bevölkerung permanent heraus, denn obwohl man eine Insel theoretisch in Ruhe lassen könnte, wetzen sich an ihr immer Mythologien, Paradiesvorstellungen, militärische Überlegungen und touristische Übergriffe ab.
Eine Insel fordert die jeweilige Bevölkerung permanent heraus, denn obwohl man eine Insel theoretisch in Ruhe lassen könnte, wetzen sich an ihr immer Mythologien, Paradiesvorstellungen, militärische Überlegungen und touristische Übergriffe ab. Bücher mit Lobeshymnen reißen die regionalen Größen einem Autor meist aus der Hand und busseln ihn ab, wenn aber Unerfreuliches in einem Aufklärungsband steht, beten viele, dass der Aufklärungskelch an ihnen vorübergehen möge.
Bücher mit Lobeshymnen reißen die regionalen Größen einem Autor meist aus der Hand und busseln ihn ab, wenn aber Unerfreuliches in einem Aufklärungsband steht, beten viele, dass der Aufklärungskelch an ihnen vorübergehen möge. Geld hat ähnlich wie Wasser mehrere Aggregatszustände, es kann in seiner Veranlagung fest, flüssig und gasförmig sein. Wenn es seine Besitzer wechselt, wird es oft zu einem heißen Ding, zu Brandgeld eben.
Geld hat ähnlich wie Wasser mehrere Aggregatszustände, es kann in seiner Veranlagung fest, flüssig und gasförmig sein. Wenn es seine Besitzer wechselt, wird es oft zu einem heißen Ding, zu Brandgeld eben. Tirol ist an manchen Tagen eine so große Sache, dass dafür das Alphabet nicht ausreicht. Wenn dann auch noch Emotionen, Zuneigung und Neugierde dazu kommen, ist das Alphabet restlos aufgebraucht.
Tirol ist an manchen Tagen eine so große Sache, dass dafür das Alphabet nicht ausreicht. Wenn dann auch noch Emotionen, Zuneigung und Neugierde dazu kommen, ist das Alphabet restlos aufgebraucht. Die Vogelfreiheit ist ein zweischneidiges Schwert, zwar ist optisch auf den ersten Blick alles eitler Sonnenschein, aber noch vor dem Horizont sind Fallen und dunkle Wolken aufgebaut.
Die Vogelfreiheit ist ein zweischneidiges Schwert, zwar ist optisch auf den ersten Blick alles eitler Sonnenschein, aber noch vor dem Horizont sind Fallen und dunkle Wolken aufgebaut.