Norman Lewis, Neapel '44
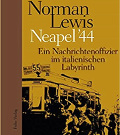 Reisebücher beschreiben meist ein Stück Geographie mit mehr oder weniger interessanten Menschen drin, eine spezielle Form ist jene, die dabei ein Stück Zeitgeschichte bereist.
Reisebücher beschreiben meist ein Stück Geographie mit mehr oder weniger interessanten Menschen drin, eine spezielle Form ist jene, die dabei ein Stück Zeitgeschichte bereist.
Norman Lewis wird 1943 in einem Schnellsiedekurs zu einem Nachrichtenoffizier für die Nachkriegszeit ausgebildet, Schwerpunkt dabei: Verwaltung eines Gebietes, das eben frisch von der Armee befreit worden ist. Ab dem Herbst 1943 ist der Erzähler etwa ein Jahr lang in Neapel stationiert, dabei ändern sich die Aufgaben beinahe stündlich.

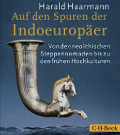 „Die meisten historischen und rezenten Weltsprachen, d. h. Sprachen mit globalem Kommunikationspotential, gehören genealogisch zur indoeuropäischen Sprachfamilie […]. Wie kam es zu dieser Erfolgsgeschichte der indoeuropäischen Sprachen? Wo liegen ihre Ursprünge?“ (11)
„Die meisten historischen und rezenten Weltsprachen, d. h. Sprachen mit globalem Kommunikationspotential, gehören genealogisch zur indoeuropäischen Sprachfamilie […]. Wie kam es zu dieser Erfolgsgeschichte der indoeuropäischen Sprachen? Wo liegen ihre Ursprünge?“ (11)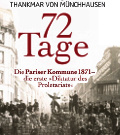 „Der bewaffnete Aufstand, der unter der Bezeichnung »Pariser Kommune« in die Geschichte der Revolutionen eingegangen ist, dauerte 72 Tage: vom 18. März bis zum 28. Mai 1871. Es war die letzte revolutionäre Bewegung in Paris nach der Französischen Revolution von 1789, der Juli-Revolution 1830 und der Revolution im Februar und Juni 1848.“ (S. 7)
„Der bewaffnete Aufstand, der unter der Bezeichnung »Pariser Kommune« in die Geschichte der Revolutionen eingegangen ist, dauerte 72 Tage: vom 18. März bis zum 28. Mai 1871. Es war die letzte revolutionäre Bewegung in Paris nach der Französischen Revolution von 1789, der Juli-Revolution 1830 und der Revolution im Februar und Juni 1848.“ (S. 7)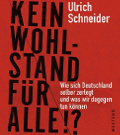 „Niemand, der mit offenen Augen durch die Lande geht, wird abstreiten können, dass Deutschland gerade dabei ist, sich selbst zu zerlegen. Der Glaube an den wenigstens bescheidenen Wohlstand für alle, der unsere Republik so lange zusammengehalten hat, ist zunehmend passé.“ (9)
„Niemand, der mit offenen Augen durch die Lande geht, wird abstreiten können, dass Deutschland gerade dabei ist, sich selbst zu zerlegen. Der Glaube an den wenigstens bescheidenen Wohlstand für alle, der unsere Republik so lange zusammengehalten hat, ist zunehmend passé.“ (9)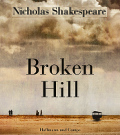 Wenn ein Ort richtig entlegen ist, fällt er mit einer Handbewegung aus Raum und Zeit. Broken Hill ist ein abgewirtschafteter Bergbau-Ort im tiefsten Australien. Mit der schrottreifen Eisenbahn ist es leichter über die Küste nach London zu gelangen als nach Sidney.
Wenn ein Ort richtig entlegen ist, fällt er mit einer Handbewegung aus Raum und Zeit. Broken Hill ist ein abgewirtschafteter Bergbau-Ort im tiefsten Australien. Mit der schrottreifen Eisenbahn ist es leichter über die Küste nach London zu gelangen als nach Sidney. Kampfschriften, Aufrufe und Epochen-Essays lösen im Idealfall viel mehr aus, als es dem meist schmalen Text auf den ersten Blick zugemutet wird. Eine Auseinandersetzung mit diesen „Text-Preziosen“ ist immer auch eine Überlegung darüber, wem so ein Diskurs nützen könnte.
Kampfschriften, Aufrufe und Epochen-Essays lösen im Idealfall viel mehr aus, als es dem meist schmalen Text auf den ersten Blick zugemutet wird. Eine Auseinandersetzung mit diesen „Text-Preziosen“ ist immer auch eine Überlegung darüber, wem so ein Diskurs nützen könnte.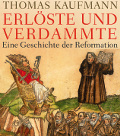 „Wittenberg, «am Rande der Zivilisation». Von diesem traditionslosen deutschen Universitätsstädtchen ausgehend wurde die Reformation binnen kürzester Zeit zu einem europäischen Ereignis. Dies war nicht zuletzt durch die politischen Strukturen und Konstellationen in Europa bedingt …“ (9)
„Wittenberg, «am Rande der Zivilisation». Von diesem traditionslosen deutschen Universitätsstädtchen ausgehend wurde die Reformation binnen kürzester Zeit zu einem europäischen Ereignis. Dies war nicht zuletzt durch die politischen Strukturen und Konstellationen in Europa bedingt …“ (9) Der Osten ist nicht nur eine Himmelsrichtung sondern auch ein Lebensgefühl, eine Farbe des Unterbewusstseins oder eine permanente Wetterlage.
Der Osten ist nicht nur eine Himmelsrichtung sondern auch ein Lebensgefühl, eine Farbe des Unterbewusstseins oder eine permanente Wetterlage. „Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass Sexuelles überall präsent ist, dass wir gelernt haben, es zu übersehen. Ironischerweise sei Pornographie durch die blanke Allgegenwart praktisch unsichtbar geworden, schreibt die Soziologin Gail Dines. Recht hat sie. Gleiches gilt allemal für das Sexuelle, das uns täglich rund um die Uhr begegnet.“ (8)
„Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass Sexuelles überall präsent ist, dass wir gelernt haben, es zu übersehen. Ironischerweise sei Pornographie durch die blanke Allgegenwart praktisch unsichtbar geworden, schreibt die Soziologin Gail Dines. Recht hat sie. Gleiches gilt allemal für das Sexuelle, das uns täglich rund um die Uhr begegnet.“ (8)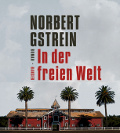 In den guten multiplen Romanen gibt es so viele Lesemöglichkeiten, dass zwei Leser im Gespräch darüber oft eine Zeitlang brauchen, um zu kapieren, dass sie den gleichen Roman gelesen haben.
In den guten multiplen Romanen gibt es so viele Lesemöglichkeiten, dass zwei Leser im Gespräch darüber oft eine Zeitlang brauchen, um zu kapieren, dass sie den gleichen Roman gelesen haben.