Joachim Gunter Hammer, Siebzehnstein
 Ein Geograph stellt sich die Poesie vielleicht als Gebirge vor, in das verschiedene Adern von Erzen eingelassen sind, ein Mathematiker als eine Formel, in der ständig neue Unbekannte auftreten, und ein Zoologe vielleicht als Schatten von Vögeln, die gerade ausgestorben sind.
Ein Geograph stellt sich die Poesie vielleicht als Gebirge vor, in das verschiedene Adern von Erzen eingelassen sind, ein Mathematiker als eine Formel, in der ständig neue Unbekannte auftreten, und ein Zoologe vielleicht als Schatten von Vögeln, die gerade ausgestorben sind.
Alle diese Zugänge sind bei Joachim Gunter Hammer zu einem sprachlichen Strang verknüpft, der letztlich auf Zug hin ins Ungewisse gespannt ist. Seit beinahe dreißig Gedichtbänden löst der Autor Fasern aus Gedankengebilden heraus, wie sie einzelne Fakultäten an den Unis lehren. Er verquirlt sie zu bislang unentdeckten Versen, die scheinbar immer schon da sind. Sie warten auf das Geschürft-Werden, mal knapp an der Oberfläche von Papier, dann wieder in der Tiefe eines Gedichtbandes, der Leser soll sich auf Überraschungen einstellen.

 Wer im literarischen Kosmos des Friedrich Hahn Heldin oder Held sein will, muss sich die Qualität eines Sandkorns im Stundenglas zulegen. Der mehrdeutige Begriff „Heimsuchung“ stellt sich im höheren Alter oft in den Weg einer glatten Biographie. Einerseits ist darunter eine soziale Einrichtung zu verstehen, worin Pflege und Obsorge als kleines Paradies angeboten werden, andererseits lässt sich eine amorphe Lebenssituation durchaus als pure Bedrohung deuten. „Ist die Suche nach dem Heim abgeschlossen, beginnt die Heimsuchung.“
Wer im literarischen Kosmos des Friedrich Hahn Heldin oder Held sein will, muss sich die Qualität eines Sandkorns im Stundenglas zulegen. Der mehrdeutige Begriff „Heimsuchung“ stellt sich im höheren Alter oft in den Weg einer glatten Biographie. Einerseits ist darunter eine soziale Einrichtung zu verstehen, worin Pflege und Obsorge als kleines Paradies angeboten werden, andererseits lässt sich eine amorphe Lebenssituation durchaus als pure Bedrohung deuten. „Ist die Suche nach dem Heim abgeschlossen, beginnt die Heimsuchung.“ „Selten kann man sich so fremd fühlen, wie beim Besuch eines Museums mit alten christlichen Bildwerken. […] Deshalb versucht dieses Buch, eine Art Ausstellung zu gestalten. Sie besteht aus zwölf Sälen, die einen Weg von den Anfängen durch die wichtigsten Epochen bis zur Gegenwart anbieten und einen Überblick über wesentliche Formen, Gattungen, Motive und Themen zu geben.“ (S. 15)
„Selten kann man sich so fremd fühlen, wie beim Besuch eines Museums mit alten christlichen Bildwerken. […] Deshalb versucht dieses Buch, eine Art Ausstellung zu gestalten. Sie besteht aus zwölf Sälen, die einen Weg von den Anfängen durch die wichtigsten Epochen bis zur Gegenwart anbieten und einen Überblick über wesentliche Formen, Gattungen, Motive und Themen zu geben.“ (S. 15)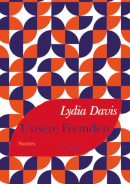 Die ideale Shortstory ist ein fiktionaler Kitt zwischen zwei scheinbar realen Situationen. Sie kann folglich jederzeit an jedem Ort auftreten und verändert ihr Erscheinungsbild zusammen mit dem Plot, den sie vorgibt zu erzählen.
Die ideale Shortstory ist ein fiktionaler Kitt zwischen zwei scheinbar realen Situationen. Sie kann folglich jederzeit an jedem Ort auftreten und verändert ihr Erscheinungsbild zusammen mit dem Plot, den sie vorgibt zu erzählen. Wenn etwas als Luftikus-Ereignis für gute Laune sorgen soll, steht es der Wissenschaft nicht gut an, durch tiefernste Forschung die Stimmung zu vermasseln. Das Dirndl ist ein Dresscode für gute Laune, Freizeit und ausgelassene Stimmung, das bevorzugte Einsatzgebiet ist das Münchner Oktoberfest, auf dem vermutlich niemand wegen seiner großer Gedanken unterwegs ist.
Wenn etwas als Luftikus-Ereignis für gute Laune sorgen soll, steht es der Wissenschaft nicht gut an, durch tiefernste Forschung die Stimmung zu vermasseln. Das Dirndl ist ein Dresscode für gute Laune, Freizeit und ausgelassene Stimmung, das bevorzugte Einsatzgebiet ist das Münchner Oktoberfest, auf dem vermutlich niemand wegen seiner großer Gedanken unterwegs ist. „Woke Ideologien entstammen den Universitäten. Dort sind sie entstanden, dort werden sie gelehrt, angeeignet und erprobt. Professoren, Instituts- und Fakultätsleitungen, ja selbst ganze Präsidien werden von woken Aktivisten und ihren akademischen Unterstützern vor sich hergetrieben. Diese geben vor, im Namen von Gerechtigkeit, Humanität und Weltoffenheit zu agieren und sich dem Kampf gegen Diskriminierung verpflichtet zu fühlen. Tatsächlich geht es um die Durchsetzung einer totalitären Ideologie, die weder gerecht noch human ist.“ (S. 13)
„Woke Ideologien entstammen den Universitäten. Dort sind sie entstanden, dort werden sie gelehrt, angeeignet und erprobt. Professoren, Instituts- und Fakultätsleitungen, ja selbst ganze Präsidien werden von woken Aktivisten und ihren akademischen Unterstützern vor sich hergetrieben. Diese geben vor, im Namen von Gerechtigkeit, Humanität und Weltoffenheit zu agieren und sich dem Kampf gegen Diskriminierung verpflichtet zu fühlen. Tatsächlich geht es um die Durchsetzung einer totalitären Ideologie, die weder gerecht noch human ist.“ (S. 13) Meist sind es die Antriebskräfte Aufbruch und Ausklang, die Menschen Gedichte formen lassen, um für sich etwas Klarheit zu schaffen über die seltsamen Vorgänge rund ums Leben.
Meist sind es die Antriebskräfte Aufbruch und Ausklang, die Menschen Gedichte formen lassen, um für sich etwas Klarheit zu schaffen über die seltsamen Vorgänge rund ums Leben. Das Jahr ist ein Teig, aus dem der Künstler unermüdlich seine Kekse heraussticht. Allmählich bildet sich daraus ein Selbst, eingespannt zwischen den Kunst-Schaffenden und den Kunst-Konsumierenden.
Das Jahr ist ein Teig, aus dem der Künstler unermüdlich seine Kekse heraussticht. Allmählich bildet sich daraus ein Selbst, eingespannt zwischen den Kunst-Schaffenden und den Kunst-Konsumierenden. Stille ist in der Literatur ein magischer Raum, der das Ich umschließt, ohne es zu bedrücken. Im Gegenteil, Stille fordert die Reduktion auf das momentan Wesentliche geradezu heraus. Die Dauer dieses Zustands kann ein paar Tage dauern wie bei der „Stillen Zeit“ um Weihnachten herum, oder einer ganzen Epoche den Stempel aufdrücken, wie in Henry Millers Roman „Stille Tage in Clichy“.
Stille ist in der Literatur ein magischer Raum, der das Ich umschließt, ohne es zu bedrücken. Im Gegenteil, Stille fordert die Reduktion auf das momentan Wesentliche geradezu heraus. Die Dauer dieses Zustands kann ein paar Tage dauern wie bei der „Stillen Zeit“ um Weihnachten herum, oder einer ganzen Epoche den Stempel aufdrücken, wie in Henry Millers Roman „Stille Tage in Clichy“. Ein Dorf ist in der Fiktion ein gern gesehener Ort, um darin Idylle, Schrecken, Wokeness oder Klimaschutz in Szene zu setzen. Mit Wimmelbildern der Kindheit wird dieser Ort gerne als analoge Wunderwelt dargestellt, worin sich die erwachsen gewordenen Kinder später einmal zurückziehen werden. Die Wirklichkeit ist freilich auch in Romanen alles andere als eine heile Welt.
Ein Dorf ist in der Fiktion ein gern gesehener Ort, um darin Idylle, Schrecken, Wokeness oder Klimaschutz in Szene zu setzen. Mit Wimmelbildern der Kindheit wird dieser Ort gerne als analoge Wunderwelt dargestellt, worin sich die erwachsen gewordenen Kinder später einmal zurückziehen werden. Die Wirklichkeit ist freilich auch in Romanen alles andere als eine heile Welt.