Sepp Kahn, Ein Bauer auf Kur
 Manche Berufsgruppen eignen sich aus politischen, religiösen oder patriotischen Gründen ganz besonders für die Hervorbringung von Helden. So hat der Arbeiter so lange den Helden gemimt, bis es keine Arbeit mehr gegeben hat, und der Bauer, gefeiertes Liebkind aus dem Ständestaat, ringt schon seit Jahrzehnten mit dem heldischen Abgang vom Hof.
Manche Berufsgruppen eignen sich aus politischen, religiösen oder patriotischen Gründen ganz besonders für die Hervorbringung von Helden. So hat der Arbeiter so lange den Helden gemimt, bis es keine Arbeit mehr gegeben hat, und der Bauer, gefeiertes Liebkind aus dem Ständestaat, ringt schon seit Jahrzehnten mit dem heldischen Abgang vom Hof.
Sepp Kahn kümmert sich stets in satirischer Form um dieses Bauernbild, das ihm an manchen Tagen unter der Hand zusammen-kugelt, noch ehe er es fertig entworfen hat. Unermüdlich wird von einer Welt erzählt, worin die Protagonisten sich zuerst in einem Klischee zeigen, dann aber sich selbst durch Bauernschläue retten und dem Publikum zeigen, dass sie noch Herr der Lage sind.

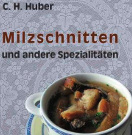 Jede gesellschaftliche Etage bringt zu gewissen Zeiten modische, kulinarische oder spielerische Gesten hervor, die eine Zeit recht gut beschreiben und hintennach als historisches Aha-Erlebnis gehandelt werden. Die Milzschnitten sind so eine Spezialität, die in diversen Haushalten des Wirtschaftswunders mit Genuss und Ekel verzehrt worden ist, ehe ihr hygienische EU-Vorschriften zumindest als Massenartikel den Garaus gemacht haben.
Jede gesellschaftliche Etage bringt zu gewissen Zeiten modische, kulinarische oder spielerische Gesten hervor, die eine Zeit recht gut beschreiben und hintennach als historisches Aha-Erlebnis gehandelt werden. Die Milzschnitten sind so eine Spezialität, die in diversen Haushalten des Wirtschaftswunders mit Genuss und Ekel verzehrt worden ist, ehe ihr hygienische EU-Vorschriften zumindest als Massenartikel den Garaus gemacht haben. Raffinierte Titel sind immer mehrdeutig wie die Lyrik überhaupt. Landaufnahmen können sich auf die Rezeption besinnen, wonach jemand Aufnahmen von einem Land macht und es als Kunstrichtung zwischen Selfie und Landschaftsmalerei ablegt. Die Landaufnahmen können sich aber auch auf die Gastfreundschaft eines Landes beziehen, wenn das Land jemanden willkommen heißt und aufnimmt.
Raffinierte Titel sind immer mehrdeutig wie die Lyrik überhaupt. Landaufnahmen können sich auf die Rezeption besinnen, wonach jemand Aufnahmen von einem Land macht und es als Kunstrichtung zwischen Selfie und Landschaftsmalerei ablegt. Die Landaufnahmen können sich aber auch auf die Gastfreundschaft eines Landes beziehen, wenn das Land jemanden willkommen heißt und aufnimmt.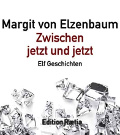 Eine Geschichte verändert sich naturgemäß, wenn sie in eine andere Sprache übersetzt wird. Oft erschließt sich der tiefere Sinn erst, wenn man den Text zweisprachig plastisch vor sich sieht wie eine Stereoaufnahme von einem Gelände.
Eine Geschichte verändert sich naturgemäß, wenn sie in eine andere Sprache übersetzt wird. Oft erschließt sich der tiefere Sinn erst, wenn man den Text zweisprachig plastisch vor sich sieht wie eine Stereoaufnahme von einem Gelände. Gebildete und emanzipierte Märchenprinzessinnen schlafen natürlich nicht mehr auf der Erbse, sondern auf exotischem Reis. Arborio gilt für Risotto-Liebhaber als Inbegriff geschmackhaften Reises.
Gebildete und emanzipierte Märchenprinzessinnen schlafen natürlich nicht mehr auf der Erbse, sondern auf exotischem Reis. Arborio gilt für Risotto-Liebhaber als Inbegriff geschmackhaften Reises.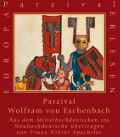 „Den Männern und den Frauen / verbot sie allen auf den Tod, / dass sie je von den Rittern sprechen. / »Denn wüsste meines Herzens Schatz, / was dieses Ritterleben sei, / dann würd‘ mir das zum großen Unheil. / Nun haltet euch an die Vernunft / und sagt nichts von der Ritterwelt.«“ (118)
„Den Männern und den Frauen / verbot sie allen auf den Tod, / dass sie je von den Rittern sprechen. / »Denn wüsste meines Herzens Schatz, / was dieses Ritterleben sei, / dann würd‘ mir das zum großen Unheil. / Nun haltet euch an die Vernunft / und sagt nichts von der Ritterwelt.«“ (118) Kräuter gelten als magische Wunderstoffe und als Lebens-Elixiere schlechthin. In der Literatur treten sie immer dann auf, wenn die Fiktion in die Realität umschlägt und die Schwerkraft in Luftigkeit. Drogenfahnder misstrauen Kräutern generell, weil ihre Anwender den Fahndern immer einen Schritt voraus sind. Vor allem ist die Zahl der Kräuter unendlich. Und in der Küche werden Kräuter als flächendeckender Trüffel eingesetzt, alles, was mit ihnen in Berührung kommt, gilt als veredelt.
Kräuter gelten als magische Wunderstoffe und als Lebens-Elixiere schlechthin. In der Literatur treten sie immer dann auf, wenn die Fiktion in die Realität umschlägt und die Schwerkraft in Luftigkeit. Drogenfahnder misstrauen Kräutern generell, weil ihre Anwender den Fahndern immer einen Schritt voraus sind. Vor allem ist die Zahl der Kräuter unendlich. Und in der Küche werden Kräuter als flächendeckender Trüffel eingesetzt, alles, was mit ihnen in Berührung kommt, gilt als veredelt.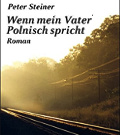 Geologen sind seltsamerweise die idealen Verbündeten, wenn es um das sorgfältige Darstellen von seelischen Verwerfungen geht. Mit der gleichen Zuneigung, mit der sie sich um die Morphologie von „Mutter Erde“ kümmern, lassen sie sich fallweise auch auf die Vorgänge von Erinnerung, Zeitgeschichte, Reisen und Lebensausblick ein.
Geologen sind seltsamerweise die idealen Verbündeten, wenn es um das sorgfältige Darstellen von seelischen Verwerfungen geht. Mit der gleichen Zuneigung, mit der sie sich um die Morphologie von „Mutter Erde“ kümmern, lassen sie sich fallweise auch auf die Vorgänge von Erinnerung, Zeitgeschichte, Reisen und Lebensausblick ein.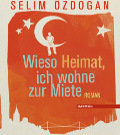 Vorurteile, Halbwahrheiten und falsche Bilder im Umgang zwischen Türken und Deutschen lassen sich in einer Welt voller politischer Correctness nur schwer darstellen. Spätestens seit sich eine türkische Majestät von einem deutschen Satiriker so beleidigt fühlt, dass dieser vor Gericht muss, überlegt man es sich als Schriftsteller dreimal, was man schreiben darf und was nicht.
Vorurteile, Halbwahrheiten und falsche Bilder im Umgang zwischen Türken und Deutschen lassen sich in einer Welt voller politischer Correctness nur schwer darstellen. Spätestens seit sich eine türkische Majestät von einem deutschen Satiriker so beleidigt fühlt, dass dieser vor Gericht muss, überlegt man es sich als Schriftsteller dreimal, was man schreiben darf und was nicht. Kampfschriften, Aufrufe und Epochen-Essays lösen im Idealfall viel mehr aus, als es dem meist schmalen Text auf den ersten Blick zugemutet wird. Eine Auseinandersetzung mit diesen „Text-Preziosen“ ist immer auch eine Überlegung darüber, wem so ein Diskurs nützen könnte.
Kampfschriften, Aufrufe und Epochen-Essays lösen im Idealfall viel mehr aus, als es dem meist schmalen Text auf den ersten Blick zugemutet wird. Eine Auseinandersetzung mit diesen „Text-Preziosen“ ist immer auch eine Überlegung darüber, wem so ein Diskurs nützen könnte.