Bernhard Aichner, Totenhaus
 Müde Schülerinnen, Lehrerinnen und Bibliothekarinnen träumen davon, dass sie etwas gelesen haben, ehe sie eingeschlafen sind, ohne dass sie etwas gelesen haben.
Müde Schülerinnen, Lehrerinnen und Bibliothekarinnen träumen davon, dass sie etwas gelesen haben, ehe sie eingeschlafen sind, ohne dass sie etwas gelesen haben.
Bernhard Aichners Thriller-Literatur zielt darauf ab, den Menschen ein Gefühl von Lektüre zu vermitteln, ohne dass sie je eine Lektüre betreiben müssen. Nach Totenfrau heißt der neue Roman jetzt Totenhaus, aber der Titel wird ohnehin kaum genannt, man verlangt nach dem neuen Aichner oder, wenn man Aichner-Profi ist, nach dem weißen, nachdem der erste schwarz gewesen ist.

 Was mag da Aufregendes herauskommen, wenn in Tübingen eine Novelle gedruckt wird, worin zwanzig Jahre nach der Matura sich Lieblingslehrer und Lieblingsschüler treffen und beide als Germanisten unterwegs sind?
Was mag da Aufregendes herauskommen, wenn in Tübingen eine Novelle gedruckt wird, worin zwanzig Jahre nach der Matura sich Lieblingslehrer und Lieblingsschüler treffen und beide als Germanisten unterwegs sind?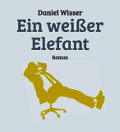 Romane aus der Arbeitswelt sind im Idealfall grotesk, um so das Ungerechte, Grausame und Sinnlose mit einem Restnutzen an Lust auszustatten.
Romane aus der Arbeitswelt sind im Idealfall grotesk, um so das Ungerechte, Grausame und Sinnlose mit einem Restnutzen an Lust auszustatten. Im Poetry Slam ist zwar jeden Tag die Hölle los und man weiß nie, wie der Abend ausgeht, die Heldinnen und Helden freilich reisen meist mit einer persönlichen Lyrik-Bibel an, die sie sich selbst geschrieben haben.
Im Poetry Slam ist zwar jeden Tag die Hölle los und man weiß nie, wie der Abend ausgeht, die Heldinnen und Helden freilich reisen meist mit einer persönlichen Lyrik-Bibel an, die sie sich selbst geschrieben haben.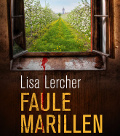 Regionalkrimis haben meist die Struktur eines Faltprospektes, der in geographischen Belangen dem Tourismus und in menschlichen Agenden der Psychiatrie huldigt. Gute Regionalkrimis führen also das touristische Publikum der Hotellerie und die Einheimischen der Psychiatrie zu.
Regionalkrimis haben meist die Struktur eines Faltprospektes, der in geographischen Belangen dem Tourismus und in menschlichen Agenden der Psychiatrie huldigt. Gute Regionalkrimis führen also das touristische Publikum der Hotellerie und die Einheimischen der Psychiatrie zu.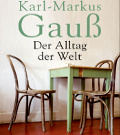 Der Sinn des Lebens hat viel damit zu tun, wie das Individuum mit der Welt zurechtkommt. Dazu muss man freilich wissen, wie die Welt im Alltagsbetrieb so tickt.
Der Sinn des Lebens hat viel damit zu tun, wie das Individuum mit der Welt zurechtkommt. Dazu muss man freilich wissen, wie die Welt im Alltagsbetrieb so tickt. „Die zentralen Ergebnisse, zu denen Hattie gekommen ist, sind in wesentlichen Teilen eigentlich banal. Aber genau darin liegt paradoxerweise der vielleicht wichtigste Beitrag seiner Arbeit: Er hat das Selbstverständliche mit solcher Wucht und so umfassend auf den Punkt gebracht, dass es künftig kaum noch möglich sein wird, die einfachen pädagogischen Wahrheiten länger zu ignorieren.“ (6)
„Die zentralen Ergebnisse, zu denen Hattie gekommen ist, sind in wesentlichen Teilen eigentlich banal. Aber genau darin liegt paradoxerweise der vielleicht wichtigste Beitrag seiner Arbeit: Er hat das Selbstverständliche mit solcher Wucht und so umfassend auf den Punkt gebracht, dass es künftig kaum noch möglich sein wird, die einfachen pädagogischen Wahrheiten länger zu ignorieren.“ (6) So etwas gibt es nur in der Literatur: Einen glatten Titel, flach wie ein Parkplatz, und gleich aufregende Lebenspraktika wie das Abschneiden von Warzen mit dem Taschenmesser und dem Geruch von am Dachboden Erhängten des letzten Winters.
So etwas gibt es nur in der Literatur: Einen glatten Titel, flach wie ein Parkplatz, und gleich aufregende Lebenspraktika wie das Abschneiden von Warzen mit dem Taschenmesser und dem Geruch von am Dachboden Erhängten des letzten Winters.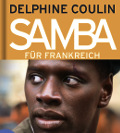 Warum tut sich das die Meeresschildkröte an, dass sie Tausende Kilometer schwimmt, um zu fressen, und dann wieder zurück hechelt, um die Eier für die nächste Generation in den Heimatsand zu vergraben?
Warum tut sich das die Meeresschildkröte an, dass sie Tausende Kilometer schwimmt, um zu fressen, und dann wieder zurück hechelt, um die Eier für die nächste Generation in den Heimatsand zu vergraben? Held dieses kleinen Kosmos hinter einem Graubündner Bahnhof ist eindeutig die Sprache. Alles, was zur Sprache kommt, klingt heimisch und exotisch zugleich.
Held dieses kleinen Kosmos hinter einem Graubündner Bahnhof ist eindeutig die Sprache. Alles, was zur Sprache kommt, klingt heimisch und exotisch zugleich.