Clemens J. Setz, Die Stunde zwischen Frau und Gitarre
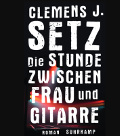 Kluge Titel evozieren die ganze Welt durch einen idealen Sehschlitz. Die Stunde zwischen Frau und Gitarre ist vielleicht ein Stillleben, das zu einem Wimmelbild ausgeufert ist.
Kluge Titel evozieren die ganze Welt durch einen idealen Sehschlitz. Die Stunde zwischen Frau und Gitarre ist vielleicht ein Stillleben, das zu einem Wimmelbild ausgeufert ist.
Clemens Setz lässt mit seinem tausendseitigen Roman nie einen Zweifel aufkommen: Jeder Satz dieses Mammutwerkes ist notwendig, um auch wirklich halbwegs alles auszuspucken, was sich in der Hauptfigur über eine gefühlte Ewigkeit hin täglich ansammelt und von früher her aufgestaut hat.

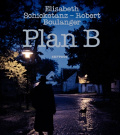 Das Digitale kämpft gegen das Animalische und ist vielleicht identisch damit! Wer einmal ein File um diesen Kampf hat verschicken wollen, kennt das Gefühl, plötzlich am Präsentierteller eines Geheimdienstes zu liegen.
Das Digitale kämpft gegen das Animalische und ist vielleicht identisch damit! Wer einmal ein File um diesen Kampf hat verschicken wollen, kennt das Gefühl, plötzlich am Präsentierteller eines Geheimdienstes zu liegen. In der guten alten Pop-Musik gibt es Heroen, Götter, Glitzer, Fans und Anbetungen wie in einer handfesten Religion. Die Mythen des auftretenden Pop-Personals sind ähnlich gestrickt wie Schöpfungsberichte oder Sagen des klassischen Altertums.
In der guten alten Pop-Musik gibt es Heroen, Götter, Glitzer, Fans und Anbetungen wie in einer handfesten Religion. Die Mythen des auftretenden Pop-Personals sind ähnlich gestrickt wie Schöpfungsberichte oder Sagen des klassischen Altertums. „Schon in der Antike beobachteten die Menschen ihre nächsten Nachbarn im Weltraum. Für Seefahrer und Landwirte, die den Himmel als Kompass und Kalender nutzten, waren die Planeten mysteriöse, wandernde Sterne, die unabhängig von den Sternbildern ihren eigenen Wegen am Himmel folgten.“ (7)
„Schon in der Antike beobachteten die Menschen ihre nächsten Nachbarn im Weltraum. Für Seefahrer und Landwirte, die den Himmel als Kompass und Kalender nutzten, waren die Planeten mysteriöse, wandernde Sterne, die unabhängig von den Sternbildern ihren eigenen Wegen am Himmel folgten.“ (7) Elementare Fragen lassen sich wenn überhaupt meist nur durch ein Gedicht klären, weil dieses ebenso unvermittelt daher kommen kann wie eine Frage.
Elementare Fragen lassen sich wenn überhaupt meist nur durch ein Gedicht klären, weil dieses ebenso unvermittelt daher kommen kann wie eine Frage. Oft ist es ein einziges Bild, das den Zustand eines Landes nach außen trägt. Im Falle Moldawiens ist es meist ein leer gefegtes Dorf, aus dem Väter und Mütter wegen der Arbeit ausgezogen sind und worin sich die Kinder mit den Alten die Welt selbst einrichten müssen.
Oft ist es ein einziges Bild, das den Zustand eines Landes nach außen trägt. Im Falle Moldawiens ist es meist ein leer gefegtes Dorf, aus dem Väter und Mütter wegen der Arbeit ausgezogen sind und worin sich die Kinder mit den Alten die Welt selbst einrichten müssen.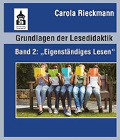 „In diesem Band soll der Blick noch einmal intensiver auf die Subjekt- und soziale Ebene der Lesekompetenz gerichtet und gefragt werden: »Was braucht man über das flüssige Dekodieren hinaus, um ein erfolgreicher Leser zu sein?«“ (1)
„In diesem Band soll der Blick noch einmal intensiver auf die Subjekt- und soziale Ebene der Lesekompetenz gerichtet und gefragt werden: »Was braucht man über das flüssige Dekodieren hinaus, um ein erfolgreicher Leser zu sein?«“ (1)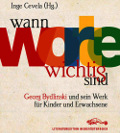 Bücher sind ja den berühmten Eisbergen ähnlich, wir sehen mit etwas Glück das Cover aus den Katalogen ragen und den Rücken aus den Regalen schimmern. Das Wesentliche und Dauerhafte der Literatur freilich bleibt uns meist verborgen und tritt nur durch Lektüre oder Veranstaltungen manchmal ins Licht der Wahrnehmung.
Bücher sind ja den berühmten Eisbergen ähnlich, wir sehen mit etwas Glück das Cover aus den Katalogen ragen und den Rücken aus den Regalen schimmern. Das Wesentliche und Dauerhafte der Literatur freilich bleibt uns meist verborgen und tritt nur durch Lektüre oder Veranstaltungen manchmal ins Licht der Wahrnehmung.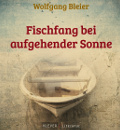 Was sich wie eine cineastische Dokumentation aus einem romantischen Gewässer anhört, ist tatsächlich nur eine von Hunderten poetischen Begegnungen, die im schrägen Sekundentakt auf den Leser einprasseln. Wolfgang Bleier nennt seine Ode an den Alltagsablauf der etwas anderen Art sehr sinnlich „Fischfang bei aufgehender Sonne“.
Was sich wie eine cineastische Dokumentation aus einem romantischen Gewässer anhört, ist tatsächlich nur eine von Hunderten poetischen Begegnungen, die im schrägen Sekundentakt auf den Leser einprasseln. Wolfgang Bleier nennt seine Ode an den Alltagsablauf der etwas anderen Art sehr sinnlich „Fischfang bei aufgehender Sonne“.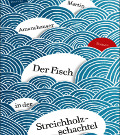 Um eine Gesellschaft so halbwegs allumfassend und gerecht beschreiben zu können, bedarf es eines außenliegenden Erzählstandpunktes, der ein Minimum an Überblick verspricht.
Um eine Gesellschaft so halbwegs allumfassend und gerecht beschreiben zu können, bedarf es eines außenliegenden Erzählstandpunktes, der ein Minimum an Überblick verspricht.