Charlotte Schubert, Der Tod der Tribune
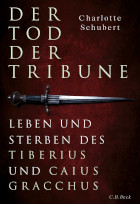 Das Leben des Brüderpaares Tiberius und Caius Gracchus war kurz, ihr Nachleben lang. Obwohl von Geburt, Herkommen und Erziehung für eine großartige Karriere bestimmt, fanden sie beide einen frühen und tragischen Tod. Ihr Schicksal bedeutete den Anfang vom Ende der römischen Republik. Wie ihre Politik, ihre großen Reformvorhaben und ihr früher Tod zusammenhängen, ist das Thema dieses Buches.
Das Leben des Brüderpaares Tiberius und Caius Gracchus war kurz, ihr Nachleben lang. Obwohl von Geburt, Herkommen und Erziehung für eine großartige Karriere bestimmt, fanden sie beide einen frühen und tragischen Tod. Ihr Schicksal bedeutete den Anfang vom Ende der römischen Republik. Wie ihre Politik, ihre großen Reformvorhaben und ihr früher Tod zusammenhängen, ist das Thema dieses Buches.
Das Geschichtsbuch „Der Tod der Tribune“ setzt sich mit der Politik der beiden Brüder Tiberius und Caius Gracchus in Rom gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. auseinander, einer Umbruchszeit, die den Anfang vom Ende der römischen Republik einleiten soll und an deren Anfang der Mord an den beiden Volkstribunen steht.

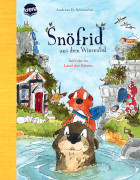 „Die Riesenkäuze tauchten nicht auf. Und während alle anderen aufgeregt plapperten, warfen Snöfrid und Björn sich einen vielsagenden Blick zu. Zum ersten Mal fragte sich Snöfrid, wo die Riesenkäuze eigentlich herkamen, wenn er sie rief. Und plötzlich mischte sich der unverkennbare Hauch von Abenteuer in den Zirbenduft.“ (S. 27)
„Die Riesenkäuze tauchten nicht auf. Und während alle anderen aufgeregt plapperten, warfen Snöfrid und Björn sich einen vielsagenden Blick zu. Zum ersten Mal fragte sich Snöfrid, wo die Riesenkäuze eigentlich herkamen, wenn er sie rief. Und plötzlich mischte sich der unverkennbare Hauch von Abenteuer in den Zirbenduft.“ (S. 27) Manchmal lässt es das literarische Glück zu, dass sich ein ganzes Land über jene Literatur freuen darf, die es mit einem Stipendium angeregt hat. Isabella Krainer hätte auch ohne Großes Tiroler Literaturstipendium den wundersamen Gedichtband „Heul doch!“ geschaffen, durch die offizielle Auslobung für 2023/24 fieberte eine kleine literarische Schar freilich dem Band entgegen, der in einem Tiroler Verlag erscheinen durfte.
Manchmal lässt es das literarische Glück zu, dass sich ein ganzes Land über jene Literatur freuen darf, die es mit einem Stipendium angeregt hat. Isabella Krainer hätte auch ohne Großes Tiroler Literaturstipendium den wundersamen Gedichtband „Heul doch!“ geschaffen, durch die offizielle Auslobung für 2023/24 fieberte eine kleine literarische Schar freilich dem Band entgegen, der in einem Tiroler Verlag erscheinen durfte.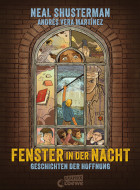 „In diesem Buch geht es um unmögliche und wundersame Ereignisse, die sich nie zugetragen haben, inmitten von unmöglichen und undenkbaren Ereignissen, die allesamt wahr sind.
„In diesem Buch geht es um unmögliche und wundersame Ereignisse, die sich nie zugetragen haben, inmitten von unmöglichen und undenkbaren Ereignissen, die allesamt wahr sind.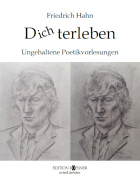 Poetikvorlesungen gelten gemeinhin als sozial hochrangige Veranstaltungen, in denen das dichtende Individuum einem akademischen Publikum die eigene Schreibtheorie anhand des eigenen Werkes vorträgt. Das Genre erweist sich als Kippmedium zwischen wissenschaftlicher Analyse und subjektiver Fiktion. Der Begriff wurde ursprünglich aus bilanztechnischen Gründen verwendet, mit dieser Bezeichnung nämlich lässt sich eine Veranstaltung im universitären Betrieb unkompliziert abrechnen.
Poetikvorlesungen gelten gemeinhin als sozial hochrangige Veranstaltungen, in denen das dichtende Individuum einem akademischen Publikum die eigene Schreibtheorie anhand des eigenen Werkes vorträgt. Das Genre erweist sich als Kippmedium zwischen wissenschaftlicher Analyse und subjektiver Fiktion. Der Begriff wurde ursprünglich aus bilanztechnischen Gründen verwendet, mit dieser Bezeichnung nämlich lässt sich eine Veranstaltung im universitären Betrieb unkompliziert abrechnen.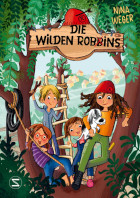 „Ja, Sommerrode ist so wunderhübsch, so fabelhaft und perfekt, dass man es kaum aushalten kann. Aber jetzt ist die Hauptstraße von Sommerrode versperrt. Mitten auf der Lupinenallee türmt sich ein riesiger Berg Modder auf. Gekrönt mit einem dicken Haufen frischer Hundekacke. Der Matsch quillt schon rechts und links auf den Radweg. Und der Gestank kriecht durch die Schießscharten-Fenster der umliegenden Häuser. Wie das passieren konnte? Tja, das Ganze hat vor einer Woche begonnen, mit der Kletten-Keilerei. Und der Ameisen-Attacke. Und dann kam der Wettbewerb, bei dem ein Drache unbedingt den ersten Preis gewinnen wollte. Aber besser der Reihe nach.“ (S. 8 f)
„Ja, Sommerrode ist so wunderhübsch, so fabelhaft und perfekt, dass man es kaum aushalten kann. Aber jetzt ist die Hauptstraße von Sommerrode versperrt. Mitten auf der Lupinenallee türmt sich ein riesiger Berg Modder auf. Gekrönt mit einem dicken Haufen frischer Hundekacke. Der Matsch quillt schon rechts und links auf den Radweg. Und der Gestank kriecht durch die Schießscharten-Fenster der umliegenden Häuser. Wie das passieren konnte? Tja, das Ganze hat vor einer Woche begonnen, mit der Kletten-Keilerei. Und der Ameisen-Attacke. Und dann kam der Wettbewerb, bei dem ein Drache unbedingt den ersten Preis gewinnen wollte. Aber besser der Reihe nach.“ (S. 8 f)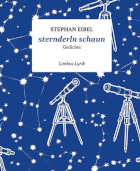 „olle san in ihrn hirn alan“ (49) – Gedichte sind wahrscheinlich ein Überdruckventil, um den Dampf der Solitude ein wenig abzulassen.
„olle san in ihrn hirn alan“ (49) – Gedichte sind wahrscheinlich ein Überdruckventil, um den Dampf der Solitude ein wenig abzulassen.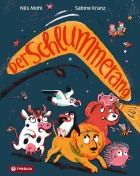 „Sind Zubettgeher und –geherinnen lange auf, nimmt unweigerlich das Schicksal seinen Lauf. Hilft nämlich mal kein Glitzerstaub, kein Zaubersand, wird von Sandmännchen oder Sandmädchen ein Geheimtrick angewandt, ins Spiel kommt dann … Tataaa!!! Der Schlummerang!“
„Sind Zubettgeher und –geherinnen lange auf, nimmt unweigerlich das Schicksal seinen Lauf. Hilft nämlich mal kein Glitzerstaub, kein Zaubersand, wird von Sandmännchen oder Sandmädchen ein Geheimtrick angewandt, ins Spiel kommt dann … Tataaa!!! Der Schlummerang!“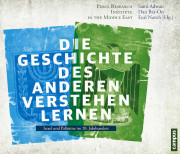 „Das übergeordnete Ziel des Projektes ist es, israelische und palästinensische Schulkinder im Alter von 15 bis 17 Jahren an die historischen Narrative des 20. Jahrhunderts der jeweils anderen Seite heranzuführen, denn diese lesen sie nicht in ihren Schulbüchern. Es soll den Kindern helfen, ihr Wissen über die offiziellen Versionen und Narrative der jeweiligen Seite hinaus zu erweitern. Es soll Geschichte aus einer vielseitigen Perspektive lehren, anstatt die Kinder weiter mit einseitigen Darstellungen zu indoktrinieren, und schließlich soll es Lehrer darin ausbilden, Geschichte/n aus der Sicht mehrerer Perspektiven zu lehren.“
„Das übergeordnete Ziel des Projektes ist es, israelische und palästinensische Schulkinder im Alter von 15 bis 17 Jahren an die historischen Narrative des 20. Jahrhunderts der jeweils anderen Seite heranzuführen, denn diese lesen sie nicht in ihren Schulbüchern. Es soll den Kindern helfen, ihr Wissen über die offiziellen Versionen und Narrative der jeweiligen Seite hinaus zu erweitern. Es soll Geschichte aus einer vielseitigen Perspektive lehren, anstatt die Kinder weiter mit einseitigen Darstellungen zu indoktrinieren, und schließlich soll es Lehrer darin ausbilden, Geschichte/n aus der Sicht mehrerer Perspektiven zu lehren.“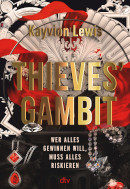 „Eine Quest kann niemandem auf der Welt trauen – außer einer anderen Quest. Wenn also eine Quest, speziell Mama Quest, mir sagt, ich solle mich wie eine Fruchtschnur verbiegen und in ein winziges Schränkchen quetschen – nicht einmal einen Hund würde man in eine Transportbox dieser Größe stecken –, so vertraue ich natürlich darauf, dass sie einen guten Grund dafür hat. Oder dass zumindest die Sache, die ich stehlen soll, es wert ist. (S. 7)
„Eine Quest kann niemandem auf der Welt trauen – außer einer anderen Quest. Wenn also eine Quest, speziell Mama Quest, mir sagt, ich solle mich wie eine Fruchtschnur verbiegen und in ein winziges Schränkchen quetschen – nicht einmal einen Hund würde man in eine Transportbox dieser Größe stecken –, so vertraue ich natürlich darauf, dass sie einen guten Grund dafür hat. Oder dass zumindest die Sache, die ich stehlen soll, es wert ist. (S. 7)