Erwin Uhrmann, Zeitalter ohne Bedürfnisse
 Wenn keine Bedürfnisse mehr da sind, hat man sie entweder selbst erfüllt, oder sie sind von sich aus abgehauen und haben die bisherigen Bedürfnisträger entleert zurückgelassen.
Wenn keine Bedürfnisse mehr da sind, hat man sie entweder selbst erfüllt, oder sie sind von sich aus abgehauen und haben die bisherigen Bedürfnisträger entleert zurückgelassen.
Erwin Uhrmann nimmt gleich vom Titel an die Leser in die Pflicht. Er stellt zwar ein Ambiente für Utopie und Dystopie zur Verfügung, die Text-User aber müssen je nach ihren Bedürfnissen sich den Roman selbst ausmalen. Das ist übrigens bei allen Romanen üblich, die nicht ein vorinstalliertes Klischee abhandeln.
„Zeitalter ohne Bedürfnisse“ lässt also ein paar Figuren auftreten, die wie beim „Mensch-ärgere-dich-nicht“ nach einer selbst-gewürfelten Zahl ein paar Schritte machen, ehe sie wieder vom Feld geworfen werden. Das Spielfeld selbst ist seltsam allgemein ins Auge gefasst als eine Landkarte ohne irgendwelche Ortsangaben. Ab und zu fallen geographische Begriffe wie Himmelsrichtungen, beispielsweise Wien, Polen oder Meer, es ist jedoch den Lesern überlassen, wie sehr sie diese Angaben mit eigenen Bildern unterlegen.

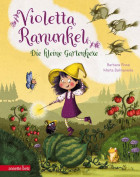 „Zauberhaft knackig sehen die Karotten aus, der Kopfsalat ist verhext groß geworden. In den prallen Tomaten steckt die ganze Magie des Sommers. Bohnen, Gurken und Brokkoli leuchten im Morgenlicht verwunschen grün. Stolz betrachtet die kleine Gartenhexe Violetta Ranunkel ihre Beete. Kein einziges Mal hat sie hier den Zauberstab eingesetzt. Alles Natur!“
„Zauberhaft knackig sehen die Karotten aus, der Kopfsalat ist verhext groß geworden. In den prallen Tomaten steckt die ganze Magie des Sommers. Bohnen, Gurken und Brokkoli leuchten im Morgenlicht verwunschen grün. Stolz betrachtet die kleine Gartenhexe Violetta Ranunkel ihre Beete. Kein einziges Mal hat sie hier den Zauberstab eingesetzt. Alles Natur!“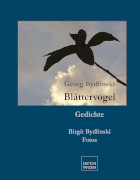 Ein richtig zusammengesetztes Wort kann in der Lyrik so etwas wie eine poetische Kernschmelze auslosen. „Blättervogel“ ist eine geniale Wortkomposition, im direkten Bild verschwindet darin ein Vogel im Blattwerk, im übertragenen Sinn geht der Vogel, lyrisches Urbild für den Flug der Zeit, in den Blättern eines Gedichtbandes auf.
Ein richtig zusammengesetztes Wort kann in der Lyrik so etwas wie eine poetische Kernschmelze auslosen. „Blättervogel“ ist eine geniale Wortkomposition, im direkten Bild verschwindet darin ein Vogel im Blattwerk, im übertragenen Sinn geht der Vogel, lyrisches Urbild für den Flug der Zeit, in den Blättern eines Gedichtbandes auf.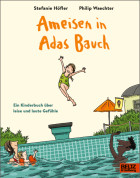 „Laila ist Adas beste Freundin. Ada und Laila haben sich auf der Rutsche kennengelernt. Ada stand unten, Laila stand oben. Da waren sie beide drei. Laila wohnte nur vier Häuser weiter und hatte ein Dreirad, das auf dem Gehweg sehr laut ratterte. Laila winkte beim Rattern und Ada guckte ihr zu. Als Ada in den Kindergarten kam, war Laila schon da. Laila hat Ada an der Hand genommen und ihr alles gezeigt.“ (S. 24)
„Laila ist Adas beste Freundin. Ada und Laila haben sich auf der Rutsche kennengelernt. Ada stand unten, Laila stand oben. Da waren sie beide drei. Laila wohnte nur vier Häuser weiter und hatte ein Dreirad, das auf dem Gehweg sehr laut ratterte. Laila winkte beim Rattern und Ada guckte ihr zu. Als Ada in den Kindergarten kam, war Laila schon da. Laila hat Ada an der Hand genommen und ihr alles gezeigt.“ (S. 24)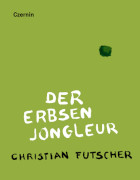 Erbsenzählen und die Prinzessin auf der Erbse – der Erbsenjongleur ist als Märchenerzähler bestens eingekleidet mit Stoff.
Erbsenzählen und die Prinzessin auf der Erbse – der Erbsenjongleur ist als Märchenerzähler bestens eingekleidet mit Stoff. „Niemand wusste, warum Charlotte anders war als alle anderen. Aber sie war es von Anfang an. Wenn die anderen Schäfchen still bei ihren Müttern standen … tobte Charlotte über Stock und Stein. Charly, der alte Hüttenhund, zeigte ihr manchmal die Zähne, aber sie hatte überhaupt keine Angst.“
„Niemand wusste, warum Charlotte anders war als alle anderen. Aber sie war es von Anfang an. Wenn die anderen Schäfchen still bei ihren Müttern standen … tobte Charlotte über Stock und Stein. Charly, der alte Hüttenhund, zeigte ihr manchmal die Zähne, aber sie hatte überhaupt keine Angst.“ In der Literatur werden Geschichten manchmal so heiß, dass man sie nur erzählen kann, wenn man gleichzeitig die Kühlelemente beschreibt, die zu ihrem Schutz installiert worden sind. „Knisternde Schädel“ sind zwanzig kleine Geschichten, die unter Überdruck in der Psychiatrie entstanden sind. Das Knistern im Kopfinnern diverser Helden deutet darauf hin, dass darin andere atmosphärische Drücke herrschen als in der sogenannten normalen Welt.
In der Literatur werden Geschichten manchmal so heiß, dass man sie nur erzählen kann, wenn man gleichzeitig die Kühlelemente beschreibt, die zu ihrem Schutz installiert worden sind. „Knisternde Schädel“ sind zwanzig kleine Geschichten, die unter Überdruck in der Psychiatrie entstanden sind. Das Knistern im Kopfinnern diverser Helden deutet darauf hin, dass darin andere atmosphärische Drücke herrschen als in der sogenannten normalen Welt.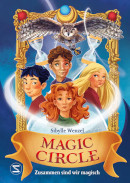 „Dann stutzte sie plötzlich und beugte sich über das Gerät, um ein Detail genauer betrachten können. »Guckt mal hier oben. Da steht etwas!« »Echt? Was denn?« Lucy schob sich neben sie. An einer der metallenen Streben, die die Sanduhr einfassten, war zwischen einigen Verzierungen in einer altmodischen geschwungenen Schriftart etwas ausgestanzt. »Was wünscht ihr euch?«, entzifferte sie laut.“ (S. 36)
„Dann stutzte sie plötzlich und beugte sich über das Gerät, um ein Detail genauer betrachten können. »Guckt mal hier oben. Da steht etwas!« »Echt? Was denn?« Lucy schob sich neben sie. An einer der metallenen Streben, die die Sanduhr einfassten, war zwischen einigen Verzierungen in einer altmodischen geschwungenen Schriftart etwas ausgestanzt. »Was wünscht ihr euch?«, entzifferte sie laut.“ (S. 36)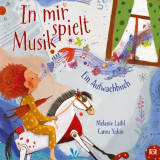 „Es ist in der Früh, / rund um mich ganz still. / Doch drin in mir spielt / Musik, wenn ich will. // Meine zwei Füße / unter der Decke / warten nur darauf, / dass ich sie wecke. // Trapp-trapp, die Sohlen, / klapp-klapp, die Zehen. / Pst … sachte trommeln / … Fliegenbeingehen …“
„Es ist in der Früh, / rund um mich ganz still. / Doch drin in mir spielt / Musik, wenn ich will. // Meine zwei Füße / unter der Decke / warten nur darauf, / dass ich sie wecke. // Trapp-trapp, die Sohlen, / klapp-klapp, die Zehen. / Pst … sachte trommeln / … Fliegenbeingehen …“ Bei der Beschäftigung mit „heimatlicher Chronik“ treten unter dem Schutt von Trivia immer wieder kleine Zeitkapseln zu Tage, worin dokumentiert ist, dass ein großer Geist an einem kleinen Ort gewohnt hat und darin vergessen worden ist.
Bei der Beschäftigung mit „heimatlicher Chronik“ treten unter dem Schutt von Trivia immer wieder kleine Zeitkapseln zu Tage, worin dokumentiert ist, dass ein großer Geist an einem kleinen Ort gewohnt hat und darin vergessen worden ist.