Andreas Niedermann, Alte Schule - Blumberg 3
 Der Dichter ist in die Berge abgehauen und gilt als verschollen, das Publikum ist ungeduldig, es hat zwei Bücher über schwere Helden-Entgleisung gelesen und will wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Die Heldin „Blumberg 3“ sitzt in der Psychiatrie und und bietet in hellen Momenten an, ihr kriminelles Leben fertig zu erzählen. – Eine ideale Ausgangsposition für einen Roman, als ein Verleger den erlösenden Schreibauftrag vergibt, um endlich alle von der Last der nicht-erzählten Geschichte zu erlösen.
Der Dichter ist in die Berge abgehauen und gilt als verschollen, das Publikum ist ungeduldig, es hat zwei Bücher über schwere Helden-Entgleisung gelesen und will wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Die Heldin „Blumberg 3“ sitzt in der Psychiatrie und und bietet in hellen Momenten an, ihr kriminelles Leben fertig zu erzählen. – Eine ideale Ausgangsposition für einen Roman, als ein Verleger den erlösenden Schreibauftrag vergibt, um endlich alle von der Last der nicht-erzählten Geschichte zu erlösen.
Andreas Niedermann lässt das Konzept für seinen „Roman noir“ knapp durchschimmern als eingedampfte Literaturtheorie: „Bücher entstehen aus Büchern, Leben und Lügen.“ (86)

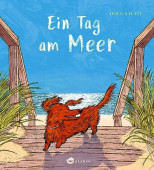 „Sommer in der Stadt, stickige Gehsteige, zertrümmerter Asphalt. Sirenen schrillen, viel zu heiß, kann nicht sitzen oder schnüffeln oder warten, überall Gedränge. Zu eng! Zu laut! Zu viel! Schluss!“
„Sommer in der Stadt, stickige Gehsteige, zertrümmerter Asphalt. Sirenen schrillen, viel zu heiß, kann nicht sitzen oder schnüffeln oder warten, überall Gedränge. Zu eng! Zu laut! Zu viel! Schluss!“ „Man hat mir nichts gegeben, was mir helfen würde zu existieren. Weder Glauben noch Hoffnung, um zu bereuen, zu bitten und erlöst zu werden.“ (45) Brane Mozetič gilt als der am meisten übersetzte slowenische Autor der Gegenwart, das hat mit seinen Themen zu tun, seiner Beharrlichkeit und der Ortsungebundenheit seiner Lyrik.
„Man hat mir nichts gegeben, was mir helfen würde zu existieren. Weder Glauben noch Hoffnung, um zu bereuen, zu bitten und erlöst zu werden.“ (45) Brane Mozetič gilt als der am meisten übersetzte slowenische Autor der Gegenwart, das hat mit seinen Themen zu tun, seiner Beharrlichkeit und der Ortsungebundenheit seiner Lyrik.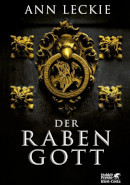 „Wenn du es vorher noch nie erlebt hattest, dann erlebtest du es jetzt. Ich glaube, es hat dich erschreckt oder verängstigt, denn während dein Blick immer noch auf Mawat gerichtet war, wichst du einen Schritt zurück und legtest eine Hand auf die Wand, als müsstest du dich abstützen. Dann drehtest du den Kopf und starrtest deine Finger an, schließlich deine Füße, als spürtest du das schwache knirschende Vibrieren in den gelblichen Steinmauern. Konntest du mich hören, Eolo? Kannst du mich jetzt hören? Ich spreche zu dir.“ (S. 27 f)
„Wenn du es vorher noch nie erlebt hattest, dann erlebtest du es jetzt. Ich glaube, es hat dich erschreckt oder verängstigt, denn während dein Blick immer noch auf Mawat gerichtet war, wichst du einen Schritt zurück und legtest eine Hand auf die Wand, als müsstest du dich abstützen. Dann drehtest du den Kopf und starrtest deine Finger an, schließlich deine Füße, als spürtest du das schwache knirschende Vibrieren in den gelblichen Steinmauern. Konntest du mich hören, Eolo? Kannst du mich jetzt hören? Ich spreche zu dir.“ (S. 27 f)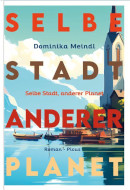 Wenn das gesellschaftliche Leben eine Inszenierung ist, muss dann nicht auch das Individuum sich selbst inszenieren? Macht es einen Unterschied, ob eine Fassade historisch gewachsen oder von einer KI gestaltet vor der Selfie-Kamera auftaucht? Ist ein absolutes System wie die Volksrepublik China vielleicht ähnlich organisiert wie die für den Tourismus ausgereizte Region rund um Hallstatt?
Wenn das gesellschaftliche Leben eine Inszenierung ist, muss dann nicht auch das Individuum sich selbst inszenieren? Macht es einen Unterschied, ob eine Fassade historisch gewachsen oder von einer KI gestaltet vor der Selfie-Kamera auftaucht? Ist ein absolutes System wie die Volksrepublik China vielleicht ähnlich organisiert wie die für den Tourismus ausgereizte Region rund um Hallstatt?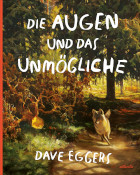 „Ich heiße Johannes und bin ein Hund. Und ich habe euch gesehen. In meinem Park, in dem ich lebe. Wenn ihr schon mal hier wart, in diesem riesengroßen grünen, windigen Park am Meer, habe ich euch gesehen. Ich sehe alle Menschen, die herkommen. Sie wandern, laufen, fahren auf Rädern, reiten auf Pferden, halten nach den Bisons Ausschau, machen Picknicks oder tragen komische Umhänge und schießen mit Pfeilen. Wenn ihr schon mal hier wart, wart ihr da, wo ich lebe, da, wo ich Die Augen bin.“ (S. 13)
„Ich heiße Johannes und bin ein Hund. Und ich habe euch gesehen. In meinem Park, in dem ich lebe. Wenn ihr schon mal hier wart, in diesem riesengroßen grünen, windigen Park am Meer, habe ich euch gesehen. Ich sehe alle Menschen, die herkommen. Sie wandern, laufen, fahren auf Rädern, reiten auf Pferden, halten nach den Bisons Ausschau, machen Picknicks oder tragen komische Umhänge und schießen mit Pfeilen. Wenn ihr schon mal hier wart, wart ihr da, wo ich lebe, da, wo ich Die Augen bin.“ (S. 13)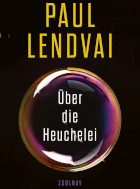 Der einzige Außenpolitiker von europäischem Rang, den Österreich momentan aufbieten kann, ist Paul Lendvai. Seit Jahrzehnten arbeitet er als Korrespondent, Journalist, Historiker und Verleger daran, die Unwissenden mit den Mächtigen in Verbindung zu bringen. Freilich hat sich etwas Glitschiges in die Nachrichtenwelt eingeschlichen: Was man früher diplomatisches Wirken genannt hat, lässt sich heute am besten mit „Heuchelei“ umschreiben.
Der einzige Außenpolitiker von europäischem Rang, den Österreich momentan aufbieten kann, ist Paul Lendvai. Seit Jahrzehnten arbeitet er als Korrespondent, Journalist, Historiker und Verleger daran, die Unwissenden mit den Mächtigen in Verbindung zu bringen. Freilich hat sich etwas Glitschiges in die Nachrichtenwelt eingeschlichen: Was man früher diplomatisches Wirken genannt hat, lässt sich heute am besten mit „Heuchelei“ umschreiben.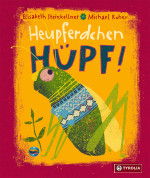 „Das kleine und das große Heupferd / hüpfen aus dem Haus, / müssen dies und das besorgen / für den Abendschmaus. // »Komm schon, Kleines«, sagt das Große. / »Wieso bleibst du sitzen?« / Kleines Heupferd sieht die Sonne / durch die Wolken blitzen.“
„Das kleine und das große Heupferd / hüpfen aus dem Haus, / müssen dies und das besorgen / für den Abendschmaus. // »Komm schon, Kleines«, sagt das Große. / »Wieso bleibst du sitzen?« / Kleines Heupferd sieht die Sonne / durch die Wolken blitzen.“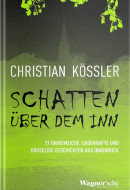 Wer eine Stadt wirklich erkunden will, muss hinter die Fassaden der Häuserzeilen blicken. Während das Navi gute Dienste leistet beim Abschreiten der Objekte, braucht es für die Geister, die dahinter stecken, meist ein Archiv, worin die historischen Seelen gespeichert sind. Die Aufgabe eines Seelen-Erweckers besteht darin, die einzelnen Quellen ausfindig zu machen und ihnen den Stöpsel zu ziehen, um die flüchtigen Gespenster in die Gegenwart zu entlassen.
Wer eine Stadt wirklich erkunden will, muss hinter die Fassaden der Häuserzeilen blicken. Während das Navi gute Dienste leistet beim Abschreiten der Objekte, braucht es für die Geister, die dahinter stecken, meist ein Archiv, worin die historischen Seelen gespeichert sind. Die Aufgabe eines Seelen-Erweckers besteht darin, die einzelnen Quellen ausfindig zu machen und ihnen den Stöpsel zu ziehen, um die flüchtigen Gespenster in die Gegenwart zu entlassen.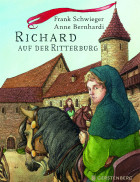 „Ritter und Burgen! Das ist oft das Erste, was uns einfällt, wenn wir an das Mittelalter denken. Oder wir stellen uns vor, dass es eine düstere Zeit war, in der die Menschen es sehr schwer hatten. Das ist alles nicht falsch, aber doch nur ein klitzekleiner Teil der großen und bunten Welt des Mittelalters.“
„Ritter und Burgen! Das ist oft das Erste, was uns einfällt, wenn wir an das Mittelalter denken. Oder wir stellen uns vor, dass es eine düstere Zeit war, in der die Menschen es sehr schwer hatten. Das ist alles nicht falsch, aber doch nur ein klitzekleiner Teil der großen und bunten Welt des Mittelalters.“