Bernhard Setzwein, Kafkas Reise durch die bucklige Welt
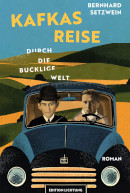 Aufregende Vorstellung: Franz Kafka hat 1924 seinen Tod nur vorgetäuscht, ist untergetaucht, hat die Nazis überlebt und erscheint nach 1945 in Meran, wo er im Apollo-Kino Karten abreißt. Als Qualifikation für diese Tätigkeit dient ihm die eigene Erzählung vom Türhüter, welcher bekanntlich streng darauf achtet, dass niemand Falscher das Gebäude betritt.
Aufregende Vorstellung: Franz Kafka hat 1924 seinen Tod nur vorgetäuscht, ist untergetaucht, hat die Nazis überlebt und erscheint nach 1945 in Meran, wo er im Apollo-Kino Karten abreißt. Als Qualifikation für diese Tätigkeit dient ihm die eigene Erzählung vom Türhüter, welcher bekanntlich streng darauf achtet, dass niemand Falscher das Gebäude betritt.
Bernhard Setzwein schöpft mit seinem Roman „Kafkas Reise durch die bucklige Welt“ in vollen Zügen aus dem Mythos „Kafkaniens“. In diesem Reich halten sich das Groteske, Bürokratische und Entgleiste die Waage. Südtirol ist als wundersamer Fixpunkt verankert: Seit 1920 Franz Kafka eine schwere Depression in Meran zu lindern versucht, wird in der Literaturszenerie diese Kurstadt zum Inbegriff für schwermütige Heilungsversuche.

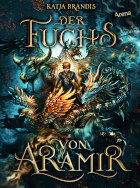 „»Was passiert, wenn ich das nicht schaffe?« »Im Hafen liegt gerade eine Galeere aus Aelius, sie muss nach einem Gefecht repariert werden«, sagte Fürst Jolon gut gelaunt. »Ich habe gehört, dass der Kapitän gerade Ruderer anheuert … oder kauft. Einen kräftigen Burschen wie Euch können die bestimmt gebrauchen.« Üblicherweise erkenne ich einen Witz, wenn ich ihn höre. Das hier war keiner. Eigentlich war Sklaverei in unserem Stadtstaat und in den meisten umliegenden Ländern längst abgeschafft.“ (S. 14)
„»Was passiert, wenn ich das nicht schaffe?« »Im Hafen liegt gerade eine Galeere aus Aelius, sie muss nach einem Gefecht repariert werden«, sagte Fürst Jolon gut gelaunt. »Ich habe gehört, dass der Kapitän gerade Ruderer anheuert … oder kauft. Einen kräftigen Burschen wie Euch können die bestimmt gebrauchen.« Üblicherweise erkenne ich einen Witz, wenn ich ihn höre. Das hier war keiner. Eigentlich war Sklaverei in unserem Stadtstaat und in den meisten umliegenden Ländern längst abgeschafft.“ (S. 14)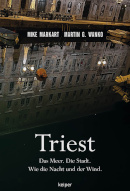 Die großen Porträts über Städte berichten nicht von den Umtrieben der Helden darin, sondern von den Anreisen, Annäherungen und Fluchten in deren Hinterland. Mike Markart und Martin G. Wanko erzählen von der magischen Stadt „Triest“ aus einer steirischen Hinterlandperspektive heraus. Die konnotierten Träume zum schroffen „Triest“ bestehen aus Meer, Stadt, Nacht und Wind.
Die großen Porträts über Städte berichten nicht von den Umtrieben der Helden darin, sondern von den Anreisen, Annäherungen und Fluchten in deren Hinterland. Mike Markart und Martin G. Wanko erzählen von der magischen Stadt „Triest“ aus einer steirischen Hinterlandperspektive heraus. Die konnotierten Träume zum schroffen „Triest“ bestehen aus Meer, Stadt, Nacht und Wind.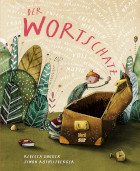 „An einem milden Herbstmorgen war Oscar beim täglichen Löcherbuddeln. Da entdeckte er eine prächtige Holztruhe. Fabelhaft! Was könnte wohl in der alten Truhe verborgen sein? Zwei Tage später. Im Nu hatte Oscar die Truhe geöffnet. Ganz anders als erwartet lagen da bloß Wörter herum. Allerhand Wörter. Ein beachtliches Durcheinander.“
„An einem milden Herbstmorgen war Oscar beim täglichen Löcherbuddeln. Da entdeckte er eine prächtige Holztruhe. Fabelhaft! Was könnte wohl in der alten Truhe verborgen sein? Zwei Tage später. Im Nu hatte Oscar die Truhe geöffnet. Ganz anders als erwartet lagen da bloß Wörter herum. Allerhand Wörter. Ein beachtliches Durcheinander.“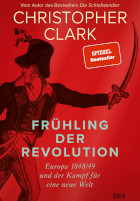 „In ihrer Intensität und geographischen Reichweite waren die Revolutionen von 1848 einzigartig – zumindest in der europäischen Geschichte. Weder die Französische Revolution von 1789 noch die Revolution von 1830, weder die Pariser Kommune von 1871 noch die russischen Revolutionen von 1905 und 1917 lösten eine vergleichbare transkontinentale Lawine aus.“ (S. 9)
„In ihrer Intensität und geographischen Reichweite waren die Revolutionen von 1848 einzigartig – zumindest in der europäischen Geschichte. Weder die Französische Revolution von 1789 noch die Revolution von 1830, weder die Pariser Kommune von 1871 noch die russischen Revolutionen von 1905 und 1917 lösten eine vergleichbare transkontinentale Lawine aus.“ (S. 9)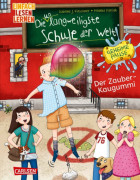 „Ding, dang, dong! Es klingelt zur Pause. Maxe wacht auf. Er hat geschlummert wie ein Murmeltier. Andere Kinder schlafen noch. Ein Junge schnarcht laut. »Ab in die Pause«, sagt Frau Penne. Sie ist die Lehrerin. Maxe und Friede laufen auf den Schulhof. »Nicht rennen!«, ruft die Lehrerin.“ (S. 10-11)
„Ding, dang, dong! Es klingelt zur Pause. Maxe wacht auf. Er hat geschlummert wie ein Murmeltier. Andere Kinder schlafen noch. Ein Junge schnarcht laut. »Ab in die Pause«, sagt Frau Penne. Sie ist die Lehrerin. Maxe und Friede laufen auf den Schulhof. »Nicht rennen!«, ruft die Lehrerin.“ (S. 10-11)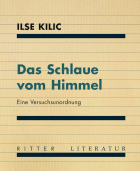 Vielleicht ist Literatur eine flüchtige Art von Materie, die sich manchmal um eine Lebensweisheit versammelt, die nach deren Verzehr wieder verschwindet.
Vielleicht ist Literatur eine flüchtige Art von Materie, die sich manchmal um eine Lebensweisheit versammelt, die nach deren Verzehr wieder verschwindet.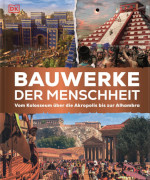 „Im Laufe der Geschichte haben Menschen auf der ganzen Welt viele außergewöhnliche Bauwerke errichtet. Dieses Buch erzählt die Geschichte von 18 dieser architektonischen Wunder auf fünf Kontinenten. Die Karte auf dieser Seite zeigt Bauwerke, die oft als die „Sieben Weltwunder“ bezeichnet werden.“ (S. 6)
„Im Laufe der Geschichte haben Menschen auf der ganzen Welt viele außergewöhnliche Bauwerke errichtet. Dieses Buch erzählt die Geschichte von 18 dieser architektonischen Wunder auf fünf Kontinenten. Die Karte auf dieser Seite zeigt Bauwerke, die oft als die „Sieben Weltwunder“ bezeichnet werden.“ (S. 6)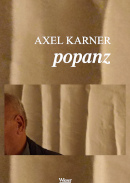 Gedichtbände springen einen oft aus dem vollen Regal heraus an, wenn sie von der semantischen Schnellkraft eines einzigen Wortes getrieben jäh ihre Dynamik entfalten.
Gedichtbände springen einen oft aus dem vollen Regal heraus an, wenn sie von der semantischen Schnellkraft eines einzigen Wortes getrieben jäh ihre Dynamik entfalten.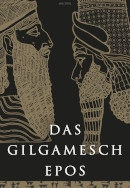 „Der alles sah, bis an die Enden der Erde, / Der alles erfuhr, alles kennenlernte, / Der alle Geheimnisse durchschaute, / Die Decke der Weisheit, die alles, die alles verhüllt. / Verwahrtes sah er, Verdecktes enthüllte er, / Von der Zeit vor der Sturmflut brachte er Kunde.“ (S. 5)
„Der alles sah, bis an die Enden der Erde, / Der alles erfuhr, alles kennenlernte, / Der alle Geheimnisse durchschaute, / Die Decke der Weisheit, die alles, die alles verhüllt. / Verwahrtes sah er, Verdecktes enthüllte er, / Von der Zeit vor der Sturmflut brachte er Kunde.“ (S. 5)