Mikaël Brun-Arnaud, Erinnerungen des Waldes
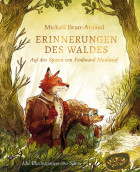 „Mitten im Dorfwald von Schönrinde und auf den Hügeln drum herum leben Tiere, die Verstand, Sprache und Humor besitzen, von eigener Pfote genähte Kleidung tragen und süßes Gebäck zaubern, dass euch davon das Wasser im Mund zusammenläuft.“ (S. 9)
„Mitten im Dorfwald von Schönrinde und auf den Hügeln drum herum leben Tiere, die Verstand, Sprache und Humor besitzen, von eigener Pfote genähte Kleidung tragen und süßes Gebäck zaubern, dass euch davon das Wasser im Mund zusammenläuft.“ (S. 9)
Archibald Fuchs, der Leiter der Dorfbuchhandlung von Schönrinde, erlebt mit dem vergesslichen Ferdinand Maulwurf sein größtes Abenteuer. Auf der Suche nach der Gegenwart und Vergangenheit des Maulwurfs führt sie die Reise durch den Dorfwald von Schönrinde und in die Vergangenheit.

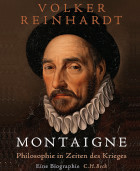 „Die so unverbindlich und tiefenentspannt daherkommenden, scheinbar willkürlich von einem Thema zum anderen springenden Essais sind in Wirklichkeit ein hoch konzentriertes, hoch politisches und daher äußerst «engagiertes» Buch, das nicht nur die Ursachen der mörderischen Konflikte ergründen, sondern diese auch beheben helfen möchte, das also nicht nur verstehen, sondern auch und vor allem verändern will.“ (S. 12)
„Die so unverbindlich und tiefenentspannt daherkommenden, scheinbar willkürlich von einem Thema zum anderen springenden Essais sind in Wirklichkeit ein hoch konzentriertes, hoch politisches und daher äußerst «engagiertes» Buch, das nicht nur die Ursachen der mörderischen Konflikte ergründen, sondern diese auch beheben helfen möchte, das also nicht nur verstehen, sondern auch und vor allem verändern will.“ (S. 12)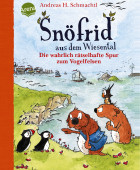 „In aller Regel begannen Snöfrids Abenteuer damit, dass irgendjemand vor dem eher kleinen Heim unter dem ehre großen Stein auftauchte und ihn um Hilfe bat. Snöfrid natürlich, nicht den Stein! Und oftmals kannte Snöfrid besagten Jemand gar nicht. An diesem Tag war das anders.“ (S. 15)
„In aller Regel begannen Snöfrids Abenteuer damit, dass irgendjemand vor dem eher kleinen Heim unter dem ehre großen Stein auftauchte und ihn um Hilfe bat. Snöfrid natürlich, nicht den Stein! Und oftmals kannte Snöfrid besagten Jemand gar nicht. An diesem Tag war das anders.“ (S. 15)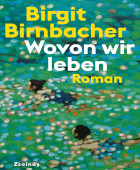 Seit die vielgepriesene Arbeit selbst bei Arbeiterparteien ihren Stellenwert verloren hat, sinnieren immer mehr an den Rand der Gesellschaft gestülpte Menschen während ihrer Spaziergänge als Freigesetzte darüber nach, „wovon wir leben“.
Seit die vielgepriesene Arbeit selbst bei Arbeiterparteien ihren Stellenwert verloren hat, sinnieren immer mehr an den Rand der Gesellschaft gestülpte Menschen während ihrer Spaziergänge als Freigesetzte darüber nach, „wovon wir leben“. 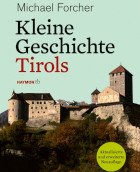 „Möge die anregende Fülle des Bildmaterials und die Kürze des Textes, der sich in wenigen Stunden lesen lässt, vielen Tirolerinnen und Tirolern, geborenen oder zugewanderten, die der Geschichte nicht viel Zeit widmen können, vielleicht auch interessierten Gästen einen ersten verlässlichen Überblick über das Werden unseres Landes ermöglichen.“ (S. 11)
„Möge die anregende Fülle des Bildmaterials und die Kürze des Textes, der sich in wenigen Stunden lesen lässt, vielen Tirolerinnen und Tirolern, geborenen oder zugewanderten, die der Geschichte nicht viel Zeit widmen können, vielleicht auch interessierten Gästen einen ersten verlässlichen Überblick über das Werden unseres Landes ermöglichen.“ (S. 11) Die politische Realverfassung eines Landes zeigt sich nicht zuletzt im Sprachgebrauch. Einerseits werden Begriffe immer bedeutungsloser und austauschbarer, wenn sie in den politischen Diskurs geraten, anderseits werden sie auch stets lächerlicher und verpönter, bis hin zum berühmten N-Wort.
Die politische Realverfassung eines Landes zeigt sich nicht zuletzt im Sprachgebrauch. Einerseits werden Begriffe immer bedeutungsloser und austauschbarer, wenn sie in den politischen Diskurs geraten, anderseits werden sie auch stets lächerlicher und verpönter, bis hin zum berühmten N-Wort.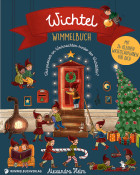 „Was duftet denn hier so köstlich? In der Wichtelbäckerei wird schon fleißig gearbeitet. Rezepte werden studiert und neue Plätzchen verkostet. Teig wird geknetet und ausgerollt, Plätzchen werden ausgestochen und auf Backbleche gelegt, die dann in den großen Holzofen geschoben werden.“
„Was duftet denn hier so köstlich? In der Wichtelbäckerei wird schon fleißig gearbeitet. Rezepte werden studiert und neue Plätzchen verkostet. Teig wird geknetet und ausgerollt, Plätzchen werden ausgestochen und auf Backbleche gelegt, die dann in den großen Holzofen geschoben werden.“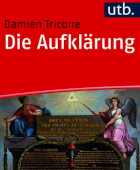 „Das vorliegende Buch ist sicherlich nicht die erste Einführung in die Geschichte und Kultur des 18. Jahrhunderts, die Einblicke in die Forschung gibt. Dennoch glaube ich, dass es sich von anderen Überblicksdarstellungen unterscheidet, weil es in einem besonderen Maße einen Spagat wagt: Das Buch versteht sich einerseits als eine Einleitung in die Geschichte und Ideenwelt der Aufklärung für Studierende […]. Andererseits durchziehen dieses Buch manche Thesen, die nicht zum Standardrepertoire in der universitären Lehre gehören und in der Forschung zum Teil umstritten sind.“ (S. 9)
„Das vorliegende Buch ist sicherlich nicht die erste Einführung in die Geschichte und Kultur des 18. Jahrhunderts, die Einblicke in die Forschung gibt. Dennoch glaube ich, dass es sich von anderen Überblicksdarstellungen unterscheidet, weil es in einem besonderen Maße einen Spagat wagt: Das Buch versteht sich einerseits als eine Einleitung in die Geschichte und Ideenwelt der Aufklärung für Studierende […]. Andererseits durchziehen dieses Buch manche Thesen, die nicht zum Standardrepertoire in der universitären Lehre gehören und in der Forschung zum Teil umstritten sind.“ (S. 9)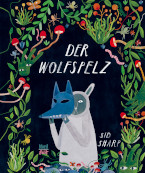 „Bellwidder Rückwelzer hatte von Blumen geträumt. Er stand auf, dehnte sich, schaute sich um, aß sein Frühstück, ließ sein Morgenbad ein und vertrieb sich ganz allein die Zeit. Doch zum Glück konnte Bellwidder das AUSGEZEICHNET.“ (S. 2-7)
„Bellwidder Rückwelzer hatte von Blumen geträumt. Er stand auf, dehnte sich, schaute sich um, aß sein Frühstück, ließ sein Morgenbad ein und vertrieb sich ganz allein die Zeit. Doch zum Glück konnte Bellwidder das AUSGEZEICHNET.“ (S. 2-7) Die Genres „Krimi“ und „Provinzi“ gehen auf das gleiche Grundelement zurück. Sowohl der Kriminalroman als auch der Provinzroman sind als unendliche Geschichte angelegt, die bis zu einem Dutzend an Fällen oder Episoden verkraftet, ohne dass sich was ändert.
Die Genres „Krimi“ und „Provinzi“ gehen auf das gleiche Grundelement zurück. Sowohl der Kriminalroman als auch der Provinzroman sind als unendliche Geschichte angelegt, die bis zu einem Dutzend an Fällen oder Episoden verkraftet, ohne dass sich was ändert.