Giulio Camagni, Der Kaiser. Maximilian I.
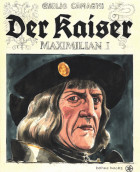 „Hofkirche, Innsbruck, 2021. Heutzutage betritt man die Kirche durch eine Seitentüre im Innenhof. Ich fühle mich klein und fehl am Platz als ich eintrete und plötzlich die mächtigen Rücken der Schwarzen Mander vor mir aufragen. Auf Zehenspitzen gehe ich um sie herum. In der Mitte befindet sich der Kenotaph, das monumentale, aber leere Grabmal, bewacht von den Ahnen des Verstorbenen. Maximilian I. von Habsburg, 1459-1519, der letzte Ritter.
„Hofkirche, Innsbruck, 2021. Heutzutage betritt man die Kirche durch eine Seitentüre im Innenhof. Ich fühle mich klein und fehl am Platz als ich eintrete und plötzlich die mächtigen Rücken der Schwarzen Mander vor mir aufragen. Auf Zehenspitzen gehe ich um sie herum. In der Mitte befindet sich der Kenotaph, das monumentale, aber leere Grabmal, bewacht von den Ahnen des Verstorbenen. Maximilian I. von Habsburg, 1459-1519, der letzte Ritter.
Gleich zu Beginn wird in einer dramatischen Szene auf einem Bauernhof in der Nähe der Stadt Innsbruck der widersprüchlichen Gestalt Kaiser Maximilians I. gedacht. Die Bauernfamilie hat soeben vom Tod des Kaiser erfahren und die Männer wollen als Landsknechte des Herrschers auf den Kaiser anstoßen. Die Frau hingegen verflucht den Kaiser, den sie für den Tod ihres Gatten verantwortlich macht und der nur Ruinen, Not und Leid zurückgelassen hat.

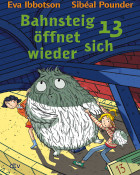 „Lina Lasky glaubte an alles, was mit Magie zu tun hatte. Sie glaubte an Zaubersprüche und Hexentränke und bewunderte Leute, die Hasen aus Zylindern zauberten. In ihren Träumen sah sie Nixen und Trolle, die mit Gemüse tanzten. Einmal, als sie tagsüber vor sich hin träumte, stellte sie sich das flauschigste aller mystischen Wesen vor …“ (S. 7)
„Lina Lasky glaubte an alles, was mit Magie zu tun hatte. Sie glaubte an Zaubersprüche und Hexentränke und bewunderte Leute, die Hasen aus Zylindern zauberten. In ihren Träumen sah sie Nixen und Trolle, die mit Gemüse tanzten. Einmal, als sie tagsüber vor sich hin träumte, stellte sie sich das flauschigste aller mystischen Wesen vor …“ (S. 7)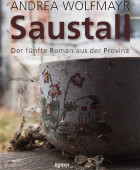 Provinz ist ein anderer Ausdruck für Österreich. – Diese literarisch etwas unterkühlte Übertreibung weist darauf hin, dass die österreichische Literatur dann am stärksten ist, wenn sie unzensiert das erzählt, was auf dem weiten, kleinen Lande so passiert.
Provinz ist ein anderer Ausdruck für Österreich. – Diese literarisch etwas unterkühlte Übertreibung weist darauf hin, dass die österreichische Literatur dann am stärksten ist, wenn sie unzensiert das erzählt, was auf dem weiten, kleinen Lande so passiert.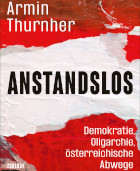 Wenn ein Begriff für sich genommen schon Grübeln auslöst, ist er ein gutes Starterkabel für das Anwerfen eines Essays. Leserschaft und Autor sitzen aufgewühlt um diesen Begriff „Anstandslos“ herum, der vielleicht zur Beschreibung der jüngeren politischen Ereignisse in Österreich dient. – Zudem eignet sich das Genre Essay besonders gut für noch nicht verfestigte Lava in der Geschichtsschreibung, die künftig mit frischem Material bewachsen sein wird.
Wenn ein Begriff für sich genommen schon Grübeln auslöst, ist er ein gutes Starterkabel für das Anwerfen eines Essays. Leserschaft und Autor sitzen aufgewühlt um diesen Begriff „Anstandslos“ herum, der vielleicht zur Beschreibung der jüngeren politischen Ereignisse in Österreich dient. – Zudem eignet sich das Genre Essay besonders gut für noch nicht verfestigte Lava in der Geschichtsschreibung, die künftig mit frischem Material bewachsen sein wird.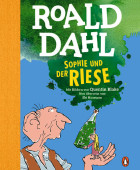 „Sophie ließ ihren Blick immer weiter die Straße hinunterschweifen. Plötzlich erstarrte sie vor Schreck. Da kam irgendetwas die Straße hoch, auf der anderen Straßenseite. Es war etwas Schwarzes … Etwas Großes und Schwarzes … Etwas sehr Großes und sehr Schwarzes und sehr Dünnes.“ (S. 13)
„Sophie ließ ihren Blick immer weiter die Straße hinunterschweifen. Plötzlich erstarrte sie vor Schreck. Da kam irgendetwas die Straße hoch, auf der anderen Straßenseite. Es war etwas Schwarzes … Etwas Großes und Schwarzes … Etwas sehr Großes und sehr Schwarzes und sehr Dünnes.“ (S. 13)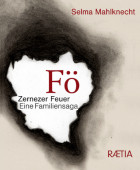 Heimat kann eine Silbe sein, ein Wort, ein Ausruf, ein Seufzer!
Heimat kann eine Silbe sein, ein Wort, ein Ausruf, ein Seufzer!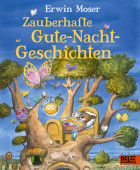 „Im Garten der beiden Mäuse Tim und Tom wuchs ein großer, gelber Kürbis. Die zwei gingen oft in den Garten und bewunderten ihn. Manchmal setzten sie sich auf den Kürbis und spielten Reiter und Pferd. Eines Tages, als sie wieder auf dem Kürbis saßen, kam Felix, der Pandabär, vorbei. Felix war ein sehr gutmütiger Bär. Ein richtiger Tollpatsch. Außerdem glaubte er alles, was man ihm sagte.“ (S. 8)
„Im Garten der beiden Mäuse Tim und Tom wuchs ein großer, gelber Kürbis. Die zwei gingen oft in den Garten und bewunderten ihn. Manchmal setzten sie sich auf den Kürbis und spielten Reiter und Pferd. Eines Tages, als sie wieder auf dem Kürbis saßen, kam Felix, der Pandabär, vorbei. Felix war ein sehr gutmütiger Bär. Ein richtiger Tollpatsch. Außerdem glaubte er alles, was man ihm sagte.“ (S. 8)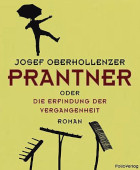 Die meisten Bücher rennen einem nach, überfallen einen und man kommt mit der Abwehr der Massenware des Literaturbetriebes nicht nach. In seltenen Fällen lassen sich Bücher ausmachen, denen man als Leser selbst nachgehen muss, sie sind verschlüsselt, geheimnisvoll und einmalig. Sie lassen sich erst lesen, wenn man zuvor Freundschaft mit dem Autor und seinem Konzept geschlossen hat.
Die meisten Bücher rennen einem nach, überfallen einen und man kommt mit der Abwehr der Massenware des Literaturbetriebes nicht nach. In seltenen Fällen lassen sich Bücher ausmachen, denen man als Leser selbst nachgehen muss, sie sind verschlüsselt, geheimnisvoll und einmalig. Sie lassen sich erst lesen, wenn man zuvor Freundschaft mit dem Autor und seinem Konzept geschlossen hat.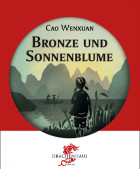 „In den Augen der Menschen aus Gerstenfeld waren die Leute der Kaderschule so etwas wie Zauberer. Die Kaderschule machte die Kinder der Bauern neugierig – vor allem auch deshalb, weil es in der Kaderschule ein kleines Mädchen gab. Alle kannten sie ausnahmslos seinen Namen: Sonnenblume.“ (S. 8)
„In den Augen der Menschen aus Gerstenfeld waren die Leute der Kaderschule so etwas wie Zauberer. Die Kaderschule machte die Kinder der Bauern neugierig – vor allem auch deshalb, weil es in der Kaderschule ein kleines Mädchen gab. Alle kannten sie ausnahmslos seinen Namen: Sonnenblume.“ (S. 8)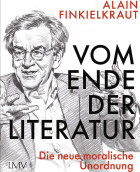 „In normalen Zeiten stehen uns zwei Mittel zur Verfügung, um zu verhindern, dass das Besondere im Allgemeinen untergeht: die Literatur und das Recht. Die Beachtung von Unterschieden und die Weigerung, pauschalierend zu denken – charakteristisch sowohl für die juristische als auch für die literarische Betrachtung des menschlichen Lebens –, bewahren uns vor ideologischem Denken. In revolutionären Zeiten aber gehen Menschlichkeit und Scharfblick solcher Art in der Flut der mitleidlosen Anteilnahme unter …“ (S. 78 f)
„In normalen Zeiten stehen uns zwei Mittel zur Verfügung, um zu verhindern, dass das Besondere im Allgemeinen untergeht: die Literatur und das Recht. Die Beachtung von Unterschieden und die Weigerung, pauschalierend zu denken – charakteristisch sowohl für die juristische als auch für die literarische Betrachtung des menschlichen Lebens –, bewahren uns vor ideologischem Denken. In revolutionären Zeiten aber gehen Menschlichkeit und Scharfblick solcher Art in der Flut der mitleidlosen Anteilnahme unter …“ (S. 78 f)