Friedrich Hahn, Jegliche Personen, jegliche Ähnlichkeiten und jegliche Handlung
 In den meisten Romanen werden kunstvoll Karrieren, Biographien oder Geschichten für das beruhigte Einschlafen konzipiert, damit sich die Leserschaft an Traumbildern hinaustasten kann aus dem Tagwerk des Alltags.
In den meisten Romanen werden kunstvoll Karrieren, Biographien oder Geschichten für das beruhigte Einschlafen konzipiert, damit sich die Leserschaft an Traumbildern hinaustasten kann aus dem Tagwerk des Alltags.
Friedrich Hahn könnte man als Meister der Dekonstruktion von Biographien bezeichnen, sein erzählerisches Augenmerk gilt den Sprüngen, die verlässlich die Karrieren seiner Protagonisten heimsuchen, sein Schwerpunkt ist so etwas wie das Leben im Ausgedinge. „Das ganze Dorf ist im Modus des Ausgedinges“, (105) heißt es über das Waldviertel, wo die ehemals Ausgewanderten zum Sterben heimkommen oder zum Verkauf ihrer Häuser an die städtischen Makler.

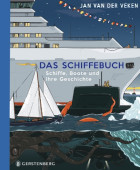 „Die Geschichte der Seefahrt beginnt mit einem Floß. Das wusste auch der norwegische Anthropologe und Abenteurer Thor Heyerdahl, der mit außergewöhnlichen Expeditionen erforschen wollte, wie alte Kulturen es bewerkstelligt haben, in neue Gebiete vorzudringen und sie zu entdecken.“ (S. 18)
„Die Geschichte der Seefahrt beginnt mit einem Floß. Das wusste auch der norwegische Anthropologe und Abenteurer Thor Heyerdahl, der mit außergewöhnlichen Expeditionen erforschen wollte, wie alte Kulturen es bewerkstelligt haben, in neue Gebiete vorzudringen und sie zu entdecken.“ (S. 18)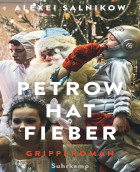 Unschuldig lesen war einmal, heutzutage gilt es, zuerst die politische Haltung abzutasten, ehe man sich an ein Buch wagen darf. Besonders heikel sind momentan Romane, die irgendwas mit dem „zweiten putinschen Krieg“ (2022) zu tun haben.
Unschuldig lesen war einmal, heutzutage gilt es, zuerst die politische Haltung abzutasten, ehe man sich an ein Buch wagen darf. Besonders heikel sind momentan Romane, die irgendwas mit dem „zweiten putinschen Krieg“ (2022) zu tun haben.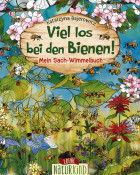 „Die Obstbäume und Sträucher stehen in voller Blüte und die Bienen summen fleißig zwischen den Zweigen umher. Dank ihrer Mühevollen Arbeit werden schon bald Äpfel, Kirschen, Birnen und Pflaumen heranreifen. Goldgelb leuchtet der Löwenzahn. Aus seinem Nektar werden die Bienen Honig machen.“
„Die Obstbäume und Sträucher stehen in voller Blüte und die Bienen summen fleißig zwischen den Zweigen umher. Dank ihrer Mühevollen Arbeit werden schon bald Äpfel, Kirschen, Birnen und Pflaumen heranreifen. Goldgelb leuchtet der Löwenzahn. Aus seinem Nektar werden die Bienen Honig machen.“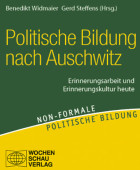 „Wie kein anderes historisches Ereignis stehen die nationalsozialistischen Verbrechen für die basale Erschütterung des Vertrauens in die zivilisatorische Selbstbegrenzung der modernen Gesellschaft. Auschwitz zerbrach die fortschrittsoptimistische Grundfigur der Aufklärung, weil sich mit der industriell organisierten Vernichtung von Menschen, dem zerstörerischen Antisemitismus und der Pervertierung des Nationalstaatsgedankens das erklärte Ziel der Aufklärung in ihr Gegenteil verkehrt hatte.“ (S. 17)
„Wie kein anderes historisches Ereignis stehen die nationalsozialistischen Verbrechen für die basale Erschütterung des Vertrauens in die zivilisatorische Selbstbegrenzung der modernen Gesellschaft. Auschwitz zerbrach die fortschrittsoptimistische Grundfigur der Aufklärung, weil sich mit der industriell organisierten Vernichtung von Menschen, dem zerstörerischen Antisemitismus und der Pervertierung des Nationalstaatsgedankens das erklärte Ziel der Aufklärung in ihr Gegenteil verkehrt hatte.“ (S. 17)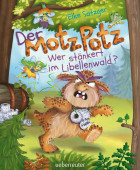 „Am Freitagmorgen um sieben Uhr tat Motzpotz das, was er täglich zu dieser Zeit tat: Erst schlug er das eine, dann das andere Auge auf. Dann zählte er bis zehn. »Eins … zwei …«, murmelte er und streckte sich ausgiebig in alle Richtungen, bis er mit seinen Händen an die Innenwand eines Fasses stieß, »… acht … neun …«“ (S. 7)
„Am Freitagmorgen um sieben Uhr tat Motzpotz das, was er täglich zu dieser Zeit tat: Erst schlug er das eine, dann das andere Auge auf. Dann zählte er bis zehn. »Eins … zwei …«, murmelte er und streckte sich ausgiebig in alle Richtungen, bis er mit seinen Händen an die Innenwand eines Fasses stieß, »… acht … neun …«“ (S. 7)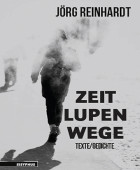 Wenn etwas für wichtig gehalten wird und eine Szene für die Wahrheitsfindung enträtselt werden soll, ist die Zeitlupe seit den Anfängen des Films eine gute Methode, der Erkenntnis auf die Sprünge zu helfen. Das gilt für forensische Abläufe oder Schadensmeldungen genauso wie für Lyrik, wo ja auch der pure Ablauf der Zeit in Poesie verwandelt werden kann, indem man eine Story verlangsamt oder eine Sequenz herunterfährt bis nahe an ein Standbild.
Wenn etwas für wichtig gehalten wird und eine Szene für die Wahrheitsfindung enträtselt werden soll, ist die Zeitlupe seit den Anfängen des Films eine gute Methode, der Erkenntnis auf die Sprünge zu helfen. Das gilt für forensische Abläufe oder Schadensmeldungen genauso wie für Lyrik, wo ja auch der pure Ablauf der Zeit in Poesie verwandelt werden kann, indem man eine Story verlangsamt oder eine Sequenz herunterfährt bis nahe an ein Standbild.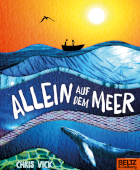 „Der Spaß war vorbei. Die Angst lag mir jetzt wie ein kalter Stein im Magen. Ich starrte auf die Rettungsweste, aber meine zitternden Hände wollten nicht wie ich. Ich war immer noch dabei, die Weste anzulegen, als uns eine Welle traf. Ich stolperte und stürzte, ließ die Rettungsweste fallen, ließ sie, vor lauter Dummheit und Ungeschick, einfach los. Ich sah, wie sie davonschlidderte, über das Deck rutschte und ins Wasser fiel.“ (S. 9)
„Der Spaß war vorbei. Die Angst lag mir jetzt wie ein kalter Stein im Magen. Ich starrte auf die Rettungsweste, aber meine zitternden Hände wollten nicht wie ich. Ich war immer noch dabei, die Weste anzulegen, als uns eine Welle traf. Ich stolperte und stürzte, ließ die Rettungsweste fallen, ließ sie, vor lauter Dummheit und Ungeschick, einfach los. Ich sah, wie sie davonschlidderte, über das Deck rutschte und ins Wasser fiel.“ (S. 9) Je nach Gemüt, Stimmung oder Zustand der intellektuellen Datenbank bringt Lyrik bei der Rezeption eine Menge Sichtweisen ins Spiel. Die zwei wichtigsten sind immer: Schlüsselwörter und Konzeption.
Je nach Gemüt, Stimmung oder Zustand der intellektuellen Datenbank bringt Lyrik bei der Rezeption eine Menge Sichtweisen ins Spiel. Die zwei wichtigsten sind immer: Schlüsselwörter und Konzeption.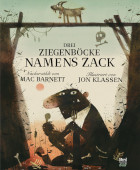 „Es war einmal eine Brücke. Und unter dieser Brücke lebte ein Troll. Der Troll saß im Schlamm, dem Schutt und dem Müll, lauschte, wartete und hoffte, jemand werde die Brücke überqueren. Ich bin ein Troll. Ich lebe um zu fressen. Ich habe hier schon viel zu lang gesessen. Wann kommt ein Tier, wann kommt ein Mann, in den ich meine Zähne schlagen kann?“
„Es war einmal eine Brücke. Und unter dieser Brücke lebte ein Troll. Der Troll saß im Schlamm, dem Schutt und dem Müll, lauschte, wartete und hoffte, jemand werde die Brücke überqueren. Ich bin ein Troll. Ich lebe um zu fressen. Ich habe hier schon viel zu lang gesessen. Wann kommt ein Tier, wann kommt ein Mann, in den ich meine Zähne schlagen kann?“