Gerald Murnane, Inland
 Zwischen Ungarn, South Dakota und Australien liegt Gras. Im Gras wird das Einfache komplex und das Komplexe einfach. Wann immer Helden vom Schreibtisch aufschauen und hinausblicken ins Freie, sehen sie Gras. Der vollkommene Roman besteht aus Gras.
Zwischen Ungarn, South Dakota und Australien liegt Gras. Im Gras wird das Einfache komplex und das Komplexe einfach. Wann immer Helden vom Schreibtisch aufschauen und hinausblicken ins Freie, sehen sie Gras. Der vollkommene Roman besteht aus Gras.
Gerald Murnanes „Inland“ duckt sich vor der Bezeichnung Roman, weil er sonst perfekt wäre. Und wie perfekt „Inland“ ist, zeigt eine Nachbemerkung, wonach der Autor ein Vierteljahrhundert nach dem Entstehen 1988 alles noch einmal durchliest und feststellt: Es ist alles ausreichend erklärt und mannigfaltig genug dargestellt. Wenn etwas nicht verstanden wird, liegt es am Leser.

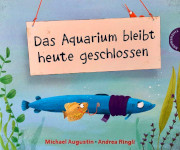 „Der Hecht fühlt sich schlecht. Der Butt ist kaputt. Der Schnapper immer schlapper. Die Flunder kaum gesunder. Die Auster noch zerzauster. Die Scholle geht’s nicht dolle. Die Quappe zieht ´ne Flappe.“
„Der Hecht fühlt sich schlecht. Der Butt ist kaputt. Der Schnapper immer schlapper. Die Flunder kaum gesunder. Die Auster noch zerzauster. Die Scholle geht’s nicht dolle. Die Quappe zieht ´ne Flappe.“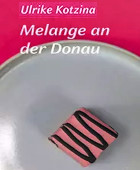 Die zwei positiven Zutaten Fluss und Getränk ergeben bei gutem Licht ein anregendes Denk- und Sitzklima. „Melange an der Donau“ beschreibt eine Menge Stimmung, die in einem Stillleben kulminiert, worin bei guter Witterung Menschen im Freien sitzen und auf die Donau blicken, während sie die Melange umrühren.
Die zwei positiven Zutaten Fluss und Getränk ergeben bei gutem Licht ein anregendes Denk- und Sitzklima. „Melange an der Donau“ beschreibt eine Menge Stimmung, die in einem Stillleben kulminiert, worin bei guter Witterung Menschen im Freien sitzen und auf die Donau blicken, während sie die Melange umrühren.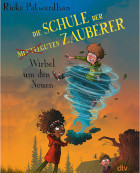 „Jahrelang hatte ich den Verdacht, dass die Mitte mein Schicksal ist. Vielleicht weil Mama mich immer allen Gästen mit den Worten vorstellte: »Und das ist Niko, unser Mittlerer.« Normalerweise hätte mich das gar nicht gestört – wenn sie nicht vorher eine Viertelstunde von den schulischen Superleistungen meines großen Bruders Jonas und der außergewöhnlichen künstlerischen Begabung meiner kleinen Schwester Nina geschwärmt hätte.“
„Jahrelang hatte ich den Verdacht, dass die Mitte mein Schicksal ist. Vielleicht weil Mama mich immer allen Gästen mit den Worten vorstellte: »Und das ist Niko, unser Mittlerer.« Normalerweise hätte mich das gar nicht gestört – wenn sie nicht vorher eine Viertelstunde von den schulischen Superleistungen meines großen Bruders Jonas und der außergewöhnlichen künstlerischen Begabung meiner kleinen Schwester Nina geschwärmt hätte.“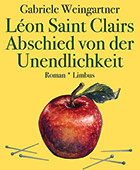 Ein Flaneur ist an jedem Augenblick am Höhepunkt! – Diese potente Zuschreibung für einen Helden, der sich quer durch Jahrhunderte und Kontinente bewegt, ermöglicht es ihm, die jeweilige Gegenwart in jener Stimmung aufzunehmen, in der wir einen gelungenen Spaziergang in den Kies setzen.
Ein Flaneur ist an jedem Augenblick am Höhepunkt! – Diese potente Zuschreibung für einen Helden, der sich quer durch Jahrhunderte und Kontinente bewegt, ermöglicht es ihm, die jeweilige Gegenwart in jener Stimmung aufzunehmen, in der wir einen gelungenen Spaziergang in den Kies setzen. „Ihr glaubt, ich esse viel? Das ist noch gar nichts. Geht mal am 31. Dezember online, wenn ich die Liveübertragung meiner Henkersmahlzeit ins Netz stelle. Leute, die zum Tode verurteilt sind, kriegen doch alle eine Henkersmahlzeit. Wieso ich nicht? Ich halte es kein Jahr mehr aus in diesem Fettleib, aber ich weiß, wie ich dieses Jahr mit einem Knalleffekt beenden kann.“ (S. 9)
„Ihr glaubt, ich esse viel? Das ist noch gar nichts. Geht mal am 31. Dezember online, wenn ich die Liveübertragung meiner Henkersmahlzeit ins Netz stelle. Leute, die zum Tode verurteilt sind, kriegen doch alle eine Henkersmahlzeit. Wieso ich nicht? Ich halte es kein Jahr mehr aus in diesem Fettleib, aber ich weiß, wie ich dieses Jahr mit einem Knalleffekt beenden kann.“ (S. 9)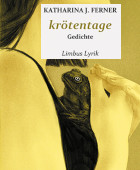 Die Nachrichtenwelt verschiebt sich ständig wie die Platten der Erdkruste. Stoßen die Textblöcke aneinander, sind oft Erschütterung und Vulkanismus angesagt. Das Individuum wird von dieser Lage mitgerissen und schützt sich, indem es sich mit einem Panzer aus Eigensinn und Eigenwelt umgibt. In dieser Erregungszone gedeihen Liebesgedichte meist vortrefflich, weil sie durch Abschirmung, Ironie und Abschweifung das Intime mit dem Zeitgeist in Verbindung bringen.
Die Nachrichtenwelt verschiebt sich ständig wie die Platten der Erdkruste. Stoßen die Textblöcke aneinander, sind oft Erschütterung und Vulkanismus angesagt. Das Individuum wird von dieser Lage mitgerissen und schützt sich, indem es sich mit einem Panzer aus Eigensinn und Eigenwelt umgibt. In dieser Erregungszone gedeihen Liebesgedichte meist vortrefflich, weil sie durch Abschirmung, Ironie und Abschweifung das Intime mit dem Zeitgeist in Verbindung bringen.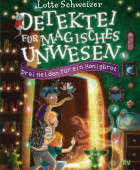 „Peggory Jones stolperte beinahe über eine Wurzel, als er durch das unterirdische Foyer des Geheimdienstes für streng geheime Angelegenheiten hastete. Seine Augen mussten sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Da halfen auch die paar schwebenden Fackeln nicht viel. »Ich bin Geheimagent und kein Maulwurf«, brummte Peggory und klopfte ein paar Erdkrümel von seinem Aktenkoffer.“ (S. 5)
„Peggory Jones stolperte beinahe über eine Wurzel, als er durch das unterirdische Foyer des Geheimdienstes für streng geheime Angelegenheiten hastete. Seine Augen mussten sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Da halfen auch die paar schwebenden Fackeln nicht viel. »Ich bin Geheimagent und kein Maulwurf«, brummte Peggory und klopfte ein paar Erdkrümel von seinem Aktenkoffer.“ (S. 5)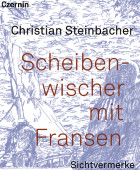 Im Flanieren durch Gärten, Vororte oder Rentnerareale bleibt man oft stehen und geht einen Schritt zurück, um sich etwas genauer anzusehen, das beim ersten Vorbeigehen nur als Irritation aufgefallen ist. „Scheibenwischer mit Fransen“ wäre so eine Begebenheit, an der man zuerst vorbeigeht, ehe man sich umdreht und die Fügung unter das sprachliche Okular nimmt.
Im Flanieren durch Gärten, Vororte oder Rentnerareale bleibt man oft stehen und geht einen Schritt zurück, um sich etwas genauer anzusehen, das beim ersten Vorbeigehen nur als Irritation aufgefallen ist. „Scheibenwischer mit Fransen“ wäre so eine Begebenheit, an der man zuerst vorbeigeht, ehe man sich umdreht und die Fügung unter das sprachliche Okular nimmt.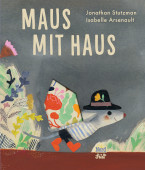 „Vincent war eine Maus mit Stiefeln an den Füßen, einem Hut auf dem Kopf und einem Haus auf dem Rücken. Er war schon weit gereist und hatte an vielen Orten gewohnt. Heute wollte er sich hier niederlassen, denn er wusste: Hier werde ich gebraucht.“
„Vincent war eine Maus mit Stiefeln an den Füßen, einem Hut auf dem Kopf und einem Haus auf dem Rücken. Er war schon weit gereist und hatte an vielen Orten gewohnt. Heute wollte er sich hier niederlassen, denn er wusste: Hier werde ich gebraucht.“