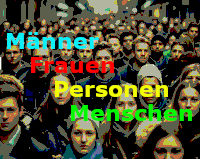 Seit Jahren ist das genderneutrale oder geschlechtsübergreifende Maskulinum, das im alltäglichen Sprachgebrauch allgemein verwendet wird, in Verruf geraten. Der Kritik liegt die Annahmen zugrunde, dass sich das genderneutrale Maskulinum nur auf Männer bezieht und Frauen lediglich mitgemeint oder gar nicht gemeint seien und damit der geforderten Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau widerspreche. Die Forderungen weitere Geschlechter als männlich und weiblich anzuerkennen, hat der Auseinandersetzung um die „geschlechtergerechte Sprache“ eine zusätzliche Dimension verliehen.
Seit Jahren ist das genderneutrale oder geschlechtsübergreifende Maskulinum, das im alltäglichen Sprachgebrauch allgemein verwendet wird, in Verruf geraten. Der Kritik liegt die Annahmen zugrunde, dass sich das genderneutrale Maskulinum nur auf Männer bezieht und Frauen lediglich mitgemeint oder gar nicht gemeint seien und damit der geforderten Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau widerspreche. Die Forderungen weitere Geschlechter als männlich und weiblich anzuerkennen, hat der Auseinandersetzung um die „geschlechtergerechte Sprache“ eine zusätzliche Dimension verliehen.
Das genderneutrale oder geschlechtsübergreifende Maskulinum gilt als sprachliches Mittel, das es ermöglicht, sich auf Personen mit unbekanntem Geschlecht zu beziehen, bei denen das Geschlecht also irrelevant ist. Es handelt sich um Aussagen, die beide Geschlechter meinen oder besser gesagt, die geschlechtsübergreifend zu verstehen sind.
1. Was kann Sprache leisten, was ist die Aufgabe von Sprache?
Prof. Dr. Katerina Stathi, Sprachwissenschaftlerin an den Univ. Münster, die u.a. zum Sprachwandel, der Grammatikalisierung sowie dem aktuellen/rezenten Sprachwandel im Deutschen forscht, weist auf die zahlreichen Missverständnisse darüber hin, was Sprache leisten kann und was nicht. Dabei kritisiert sie an der Diskussion über Gendersprache die große Unkenntnis darüber, was Sprache leisten kann und was nicht. Welche Funktionen, Strukturen und kognitiven Prinzipien liegen der Struktur, aber auch dem Gebrauch und Wandel der Sprache zugrunde?
Verfechter des Genderns in der Sprache wollen eine gesellschaftliche Gleichbehandlung von Männern, Frauen und darüber hinaus einem „dritten Geschlecht“ in der Sprache abgebildet sehen. Dahinter steckt die Meinung, dass das „generische Maskulinum“ ausschließlich männliche Personen repräsentiere. Dabei würden Frauen u.a. unsichtbar bleiben und lediglich mitgemeint sein. Die deutsche Sprache erscheint als „Männersprache“, mit einer grundsätzlich diskriminierenden Struktur. (vgl. Stathi, S. 2)
Als Konsequenz dieser These wird gefordert, die Sprache aktiv gerechter umzugestalten. Im Zentrum der Auseinandersetzung um die Gendersprache steht also das generische oder geschlechterübergreifende Maskulinum.

Wie kommen Männer, Frauen und Gruppen sprachlich zum
Ausdruck?
2. Wie kommt das Geschlecht in der deutschen Sprache zum Ausdruck?
Mit Sprache lassen sich grundsätzlich alle Informationen ausdrücken, die für eine Sprachgemeinschaft relevant, wichtig und häufig sind. Die deutsche Sprache bietet verschiedene Möglichkeiten, das Geschlecht auszudrücken. Es gibt Wörter, die das Geschlecht bezeichnen wie z.B. Stute – Hengst, Sau – Eber, Bache – Keiler, u.a. Es gibt aber auch grammatische Formen wie Eselin, Hündin, Bäckerin, Lehrerin. Die Möglichkeiten ein Geschlecht zu bezeichnen, geben die vorhandenen Wörter, die Strukturen der Sprache und die Konventionen des Sprachgebrauchs vor. So gibt es im deutschen zwar ein Wort für ein weibliches Pferd (Stute) aber kein Wort für ein weibliches Krokodil, was als lexikalische Lücke bezeichnet wird. (vgl. Stathi, S. 4)
Grundsätzlich werden in einer Sprache nur so viele Informationen verpackt, wie für eine gewünschte Aussage nötig sind. Zu viele unnötige Informationen machen eine Aussage schwer verständlich. Die Sprache bietet die Möglichkeit, mehr oder weniger präzise zu sein, indem Begriffe auf verschiedenen Ebenen gewählt werden können, wie z.B. Pferd – Stute; Baum – Eiche; trinken – schlürfen.
In diesem Sinn kann im Deutschen eine Aussage allgemein gehalten werden, wenn das Geschlecht der handelnden oder gemeinten Person irrelevant ist. Es kann aber auch zum Ausdruck gebracht werden, wenn es gewünscht oder erforderlich ist. So beziehen sich z.B. die Pronomen „ich, du, wir, ihr“ auf kein Geschlecht, während die Pronomen“ er, sie, es“ auf ein Geschlecht verweisen können. Meist beziehen sie sich aber auf ein Substantiv mit dem entsprechenden Genus: der Baum (er/ihn), die Schaufel (sie/sie) (vgl. Stathi, S. 4)
Die Information „Geschlecht“ kann in einfachen, nicht zusammengesetzten Wörtern sein:
Frau, Tochter, Tante, Mutter, Stute
Mann, Sohn, Onkel, Vater, Hengst
Hier ist das Geschlecht formal nicht sichtbar, sondern die Bedeutung durch das Wort selbst gegeben. Das Geschlecht kann aber auch durch die Wortgrammatik ausgedrückt werden z.B. durch das Affix „-in“, das an die Grundform angehängt wird.
Lehrer – Lehrerin, Löwe – Löwin, Apotheker – Apothekerin
Es gibt im deutschen hingegen kein vergleichbares Element, um explizit männliche Lebewesen zu bezeichnen.
Auch durch Phrasen lässt sich das Geschlecht ausdrücken:
ein männliches Tier, die männlichen Teilnehmer, die weiblichen Gäste, die weiblichen Führungskräfte
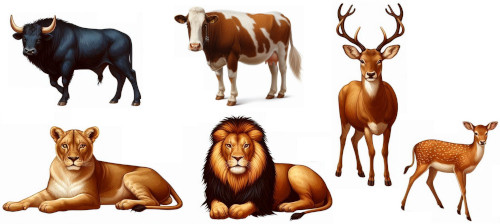
Auch bei Tieren kommen verschiedene Geschlechter unterschiedlich
zum Ausdruck: Löwe-Löwin, Hirsch-Hirschkuh, Stier-Kuh
Grundsätzlich wird immer das genannt, was für eine Aussage von Bedeutung ist. Informationen die darüber hinausgehen, überfrachten die Kommunikation und erschweren das Verständnis. (vgl. Stathi, S. 5)
3. Was ist das Genus im Gegensatz zum Sexus?
Im deutschen werden Substantive in drei Klassen unterteilt: Maskulinum (der Löffel), Femininum (die Gabel) und Neutrum (das Messer). Beim Genus handelt es sich um eine grammatische Kategorie des Substantivs, daneben finden wir noch die Kategorien Kasus (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ) und Numerus (Singular, Plural).
Das Wort „Genus“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Gattung, Art, Klasse“ sekundär aber auch „Herkunft, Geschlecht, Familie“. Nicht alle Sprachen weisen ein Genus-System auf, das Substantive in Klassen unterteilt, in denen Substantive formale Ähnlichkeiten bei der Bildung von Kasus und Numerus haben. Beim Genus handelt es sich also um eine innersprachliche Kategorie des Substantivs.
Die Zuordnung eines Substantivs zu einem Genus ist das Resultat einer historischen Entwicklung. Dabei spielen formale und semantische (Bedeutung) Prinzipien eine Rolle, die miteinander interagieren können. Alle Maskulina und Neutra bilden den Genitiv durch die Endung „-s“, die Feminina nicht. Bei einfachen, nicht zusammengesetzten Wörtern spielt das biologische Geschlecht (Sexus) eine wesentliche Rolle (vgl. Stathi, S. 7), z.B.:
Mann, Frau, Opa, Oma, Vater, Mutter, Tante, Onkel, Schwester, Bruder etc.
Es gibt nur wenige Personenbezeichnungen, wo die Seme, also die kleinsten Elemente der Bedeutung von Wörtern, „männlich“ bzw. „weiblich“ mit den Genera Maskulinum bzw. Femininum in eindeutiger Weise zusammenhängen.
Archilexeme: Mann und Frau
Verwandtschaftsbezeichnungen: Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, Opa, Oma, Onkel, Tante,
Neffe, Nichte, Vetter, Base, Cousin, Cousine
Lexeme wie Frau, Dame, Mutter, Tochter u.a. drücken als solche „weibliches Geschlecht“ aus. Ihr feminines Genus macht sie nicht weiblicher. Umgekehrt gilt das Gleiche auch für männliche Bezeichnungen wie Mann, Vater, Herr, Sohn etc. Während Genus also ein abstrakt-grammatisches Merkmal darstellt, das auch unbelebten Elementen wie Löffel, Hammer, Gabel etc. zukommt, ist Sexus dem biologischen Geschlecht von Lebewesen mit der Spezifikation „männlich“ oder „weiblich“ vorbehalten. (vgl. Meinecke, S. 42 ff)
Für die Genus-Zuweisung spielen aber auch andere Merkmale als das Geschlecht eine Rolle. Das heißt aber nicht, dass sich Genus und Sexus entsprechen müssen. Die Bezeichnungen der Mensch, die Person, der Gast, die Geisel, die Koryphäe, das Opfer, das Mitglied u.a. beziehen sich auf alle Geschlechter.
Bei einfachen Wörtern, die Menschen bezeichnen, können Genus und Sexus übereinstimmen, müssen es aber nicht. Bei abgeleiteten Wörtern bestimmt das Suffix das Genus des Wortes, also das Wortbildungselement das auf den Wortstamm folgt.
„-chen“ bildet Neutra: Mädchen, Hölzchen, Mäuschen, etc.
„-ling“ bildet Maskulina: Lehrling, Flüchtling, Säugling, etc.
„-ung“ bildet Feminina: Verbreitung, Regierung, Abteilung, etc.
„-er“ bildet Maskulina: Fahrer, Maler, Spieler, Lehrer, etc.
Substantive auf „-er“ sind Nomina agentis, Bezeichnungen für handelnde Personen, also meist Täter- oder Berufsbezeichnungen. Ein Bäcker ist eine Person, die diesen Beruf ausübt. Auch wenn diese Substantive maskulin sind, haben sie keinen direkten Bezug zu einem Sexus. Das maskuline Genus stammt allein vom Suffix „-er“, wie „-ling“ ein feminines Genus erfordert.
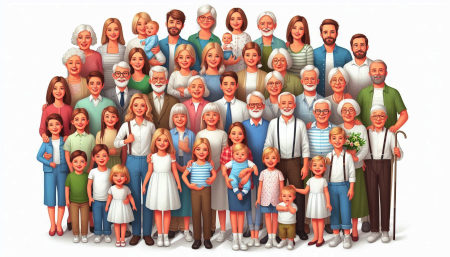
Verwandtschaftsbezeichnungen wie Vater, Mutter, Opa, Oma,
Tochter, Sohn u.a. drücken als solche das Geschlecht aus.
Im Gegensatz zum Suffix „-ling“ kann beim Suffix „-er“ ein weiteres Suffix „-in“ angehängt werden, mit dem zusätzlich das Bedeutungsmerkmal „weiblich“ hinzugefügt wird. Das Suffix „-in“ verweist damit explizit auf Frauen. Für Männer gibt es kein analoges Suffix. Die Form ohne „-in“ verweist damit aber nicht automatisch auf eine männliche Person. Während „Apotheker“ sich auf Personen, unabhängig vom Geschlecht bezieht, meint „Apothekerin“ eindeutig nur eine weibliche Person.
Das Suffix „-er“ markiert kein Geschlecht.
Das Suffix „-in“ markiert das weibliche Geschlecht.
Dies zeigt sich daran, dass sich keine weibliche Markierung mit „-in“ anbringen ließe, wenn „-er“ männlich markiert wäre.

Ein Wort, das in seiner Bedeutungsstruktur ein Merkmal für Geschlecht aufweist, kann nicht dazu verwendet werden, um auf das andere Geschlecht hinzuweisen.
Lehrer sind häufig überfordert (= männliche und weibliche Lehrer)
Söhne sind häufig überfordert (= ungleich männliche und weibliche Söhne)
Im deutschen lässt sich das Genus nicht eindeutig am Substantiv selbst erkennen, sondern an den Begleitern des Substantivs wie Artikel (der, die das), Pronomen (sein, ihre, diese, jener, welches u.a.) oder Adjektive (ein kluger Mann, eine kluge Frau). Im Plural fällt die formale Unterscheidung hingegen aus: die klugen Männer, die klugen Frauen. Aus diesem Grund wird besonders gern im Plural gegendert, weil die formalen Schwierigkeiten dabei geringer ausfallen. (vgl. Stathi, S. 7)
Sexus-Merkmale müssen, um grammatikalisch sichtbar zu werden, als Genus-Merkmale sprachlich zum Ausdruck kommen. „Sexus“ nutzt dabei die Kategorie „Genus“ als Unterstützung. Umgekehrt wirkt sich die Genus-Markierung auf die inhaltliche Sexus-Wahrnehmung aus. Dieses psychologisch belegte Phänomen stellt aber eine grammatisch getriggerte Suggestion dar, die gezielt in Assoziationsstudien herangezogen wird, um die Wichtigkeit „gendergerechter Sprache“ zu belegen. Dem liegt ein Missverständnis über das Verhältnis zwischen lexikalischer Bedeutung und Assoziationen zugrunde, die durch das Genus ausgelöst werden. (vgl. Meinecke, S. 26)
4. Was ist das genderneutrale, geschlechtsübergreifende Maskulinum?
Das generische Maskulinum ist die unmarkierte Form oder Grundform von Substantiven mit dem Suffix „-er“. Es steht in einem generischen Kontext, wenn Aussagen über eine Gattung, eine Klasse von Individuen gemacht werden, z.B.:
Löwen sind Raubtiere.
Der Löwe ist ein Raubtier.
Lehrer müssen sich regelmäßig weiterbilden.
Ein Lehrer muss sich regelmäßig weiterbilden.
Es geht um Aussagen über alle Löwen und alle Lehrer. Das konkrete Individuum sowie spezifische Merkmale wie das Geschlecht sind nicht von Interesse. Deshalb wird für solche Aussagen die kürzeste und unmarkierte Form verwendet. (vgl. Stathi, S. 8)

Das genderneutrale Maskulinum wird für Aussagen verwendet,
in denen das Geschlecht der Person keine Rolle spielt.
Das genderneutrale Maskulinum finden wir nicht nur in der deutschen Sprache, sondern in vielen Genus-Sprachen. Selbst Sprachen ohne Genus belegen die Genderneutralität morphologisch unmarkierter Lexeme. Eine grammatische Kategorie erscheint zunächst primär unspezifisch, kann daneben aber kontextbedingt spezifische Funktionen aufweisen. (vgl. Meinecke S. 12 f)
Im Fall von Epikoina, das sind Substantive, die sich sowohl auf männliche als auch weibliche Personen oder Tiere beziehen, gibt nur ein Genus. Männliche und weibliche Individuen müssen durch zusätzliche Beschreibungen spezifiziert werden. Es handelt sich um die Bezeichnung geschlechtlicher Wesen, die aber in einer bestimmten Sprache nicht nach dem Geschlecht unterschieden werden. Beispiele dafür sind:
der Mensch, die Hilfskraft, die Waise, das Genie, die Person, das Mitglied,
der Adler, die Katze, der Esel, die Giraffe, das Pferd etc.
Wenn ein Pronomen auf ein Epikoinon folgt, stehen zwei Möglichkeiten offen. Es kann dessen Genus grammatisch aufnehmen: das Mitglied – es (wird überwiegend verwendet) oder es kann aber auch referentiell auf die gemeinte Person verweisen: das Mitglied – sie/er.
Es gibt aber auch Fälle, wo Genus und Sexus nicht übereinstimmen, wie z.B. Mädchen, das den Genus Neutrum und den Sexus weiblich aufweist. (vgl. Meinecke, S. 15-17)
Geschlechtsneutrale Wörter können zwar einen Mann, eine Frau oder mehrere Personen bezeichnen, müssen es aber nicht. Beispiele:
der Abkömmling, der Beistand, der Eindringling, der Drilling, der Flüchtling,
der Mensch, der Trotzkopf u.a.
die Gallionsfigur, die Geisel, die Geistesgröße, die Gestalt, die Koryphäe,
die Kreatur, die Leiche, die Persönlichkeit u.a.
das Ass, das Baby, das Geschöpf, das Geschwister, das Mitglied, das Model,
das Neugeborene, das Oberhaupt, das Talent u.a.
Diese Wörter tragen in ihrem Genus nur die Information, welcher Flexionsklasse sie angehören. Sie enthalten inhaltlich keine Komponenten für „männlich“ oder „weiblich“. (vgl. Meinecke, S. 36 ff)
>> Das genderneutrale Maskulinum: Sprachökonomie im ideologischen Spannungsfeld - Teil 2
>> Das genderneutrale Maskulinum: Sprachökonomie im ideologischen Spannungsfeld - Teil 3
Weiterführenden Links:
- Linguistik vs. Gendern: Gendersprache-Vermeidungsgesetz WDR. Anhörung des Ausschusses für Kultur und Medien am 2. März 2023. Schriftliche Stellungnahme Prof. Dr. Katerina Stathi
- Lesen in Tirol: Eckhard Meineke, Studien zum genderneutralen Maskulinum
- Informationsethik: Über die „Studien zum genderneutralen Maskulinum“ von Eckhard Meineke
- Telepolis: Studie zum Gendern: Deutliche Worte, klare Fakten, wohldosierte Emotion
- Netzwerk Bibel und Bekenntnis: Offener Brief an die theologischen Ausbildungsstätten des deutschsprachigen Raums: Einspruch gegen die Nötigung zur Verwendung sog. „geschlechtergerechter Sprache“
- Handbuch geschlechtergerechte Sprache (Leseprobe)
Andreas Markt-Huter, 26-05-2025
