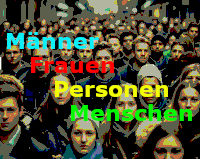 Seit Jahren ist das genderneutrale oder geschlechtsübergreifende Maskulinum, das im alltäglichen Sprachgebrauch allgemein verwendet wird, in Verruf geraten. Der Kritik liegt die Annahmen zugrunde, dass sich das genderneutrale Maskulinum nur auf Männer bezieht und Frauen lediglich mitgemeint oder gar nicht gemeint seien und damit der geforderten Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau widerspreche. Die Forderungen weitere Geschlechter als männlich und weiblich anzuerkennen, hat der Auseinandersetzung um die „geschlechtergerechte Sprache“ eine zusätzliche Dimension verliehen.
Seit Jahren ist das genderneutrale oder geschlechtsübergreifende Maskulinum, das im alltäglichen Sprachgebrauch allgemein verwendet wird, in Verruf geraten. Der Kritik liegt die Annahmen zugrunde, dass sich das genderneutrale Maskulinum nur auf Männer bezieht und Frauen lediglich mitgemeint oder gar nicht gemeint seien und damit der geforderten Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau widerspreche. Die Forderungen weitere Geschlechter als männlich und weiblich anzuerkennen, hat der Auseinandersetzung um die „geschlechtergerechte Sprache“ eine zusätzliche Dimension verliehen.
Das genderneutrale oder geschlechtsübergreifende Maskulinum gilt als sprachliches Mittel, das es ermöglicht, sich auf Personen mit unbekanntem Geschlecht zu beziehen, bei denen das Geschlecht also irrelevant ist. Es handelt sich um Aussagen, die beide Geschlechter meinen oder besser gesagt, die geschlechtsübergreifend zu verstehen sind.
* * * * * * * Teil 2 * * * * * * *
5. Was sind die historischen Ursachen für die feministische Auffassung, dass ein genderneutrales Maskulinum nur männliche Personen meint?
Das geschlechtsübergreifende Maskulinum tritt als solches im Deutschen bereits seit jeher auf und lässt sich z.B. im Monseer Fragment um 800, im 11. Jhd. bei Notker, im 13. Jhd. im Nibelungenlied, im 16. Jhd. bei Luther und im 19. Jhd. bei Goethe finden. (vgl. Meinecke, S. 233)
Die Sexualisierung der Grammatik nahm ihren Anfang im 19. Jahrhundert bei Jacob Grimm, der das Femininum mit dem weiblichen und das Maskulinum mit dem männlichen Geschlecht verknüpfte. Die Theorie vom Genus als Metapher für den menschlichen Sexus kam aber bereits im 18. Jahrhundert bei Johann Gottfried Herder und Johann Christoph Adelung auf und wurde von Friedrich Schlegel, Friedrich Wilhelm Schelling, Wilhelm von Humbold bis Jacob Grimm weitergeführt. Dabei gilt Jacob Grimms Genus-Theorie mittlerweile als widerlegt, weil sie weder die Genus-Verhältnisse bei den Abstrakta erklären noch verständlich machen kann, wie der Genus der Konkreta von einer kleinen Menge Sexus bezeichnender Nomina herrühren soll. Grimm setzt in seiner Theorie die Begriffe Genus und Sexus gleich, bzw. vermischt sie, obwohl die Kategorie Sexus keine grammatische, sondern eine biologische ist. Die Erklärungen der sexualistischen Genus-Theorie beruhen auf rein psychologischen und soziologischen, nicht aber auf sprachwissenschaftlichen Motiven. (vgl. Meinecke, S. 235)
Dahinter steckt eine im 18. Jahrhundert aufkommende neue Menschenkunde, die sich für den als exotisch verstandenen „anderen Menschen“ interessiert: die Wilden, die Schwarzen, hoch- oder tiefstehende Nationen, aber auch das andere Geschlecht - die Frauen. Ein breites Publikum ließ sich für eine sexualisierte Genus-Theorie weit leichter interessieren, als für schwerer verständliche, rein grammatisch orientierte Erklärungen.
Jacob Grimm ließ in seiner Theorie das grammatische Genus aus dem natürlichen, biologischen Geschlecht entstanden sein. Interessanterweise kritisiert die feministische Linguistik Grimms Verwendung des genderneutralen Maskulinums als Beleg für die propagierte Überlegenheit des Mannes, die damit verbunden sei, während seine Theorie gleichzeitig als Grundlage der Kritik übernommen und zur Basis femininer Movierung macht wird. (vgl. Meinecke, S. 235-238)
Eine weitere Ursache, die Missverständnisse im Gebrauch des generischen Maskulinums eröffnet, geht auf die Barockzeit zurück, wo das substantivische Genus als grammatisches Geschlecht, oft auch als weibliches/männliches Geschlecht übersetzt wurde. In Wirklichkeit bedeutet der grammatikalische Begriff Genus jedoch „Art“ oder „Gattung“ und hat nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun. (vgl. Meinecke, S. 239)
6. Zur Korrelation von Genus und Sexus
Bei einer Gleichsetzung von Genus und Sexus, wie es das Gendern voraussetzt, wird zusätzlich der Umstand zum Problem, dass sich beim deutschen Substantiv die Genus-Zuweisung in 90 % aller Fälle aufgrund der lautlichen Form erschließen lässt. (vgl. Meinecke, S. 239)

Ob die Bezeichnung Zuschauer geschlechtsübergreifend alle
Zuschauer meint oder nur einen männlichen Zuschauer,
ergibt sich aus dem Kontext.
Die Befürworter des Genderns bauen ihre Kritik daran auf, dass ein generisch verwendetes grammatisches Maskulinum auch ein männliches Individuum bezeichnen kann.
Der Zuschauer der Löwe
der Zuschauer die Zuschauer-in der Löwe die Löw-in
Die Form Zuschauer ist dabei doppeldeutig, weil sie sowohl den Oberbegriff, die Gattung aller „Personen, die zuschauen“, als auch ein männliches Individuum, das zuschaut, bezeichnen kann. Dasselbe trifft auch auf viele Tierbezeichnungen zu. (vgl. Stathi, S. 8)
Um das genderneutrale Maskulinum in richtiger Weise verstehen zu wollen, muss mit Hilfe einer kleinen gedanklichen Abstraktion davon abgesehen werden, dass Wörter wie Mieter, Leser, Chef, Arzt u.a. Maskulina sind, die sich in bestimmten Kontexten auf männliche Personen beziehen können. (vgl. Meinecke, S. 9)
Zu unterscheiden sind die lexikalische Ebene und die Ebene der Bedeutung von Sprachzeichen (Wortsemantik, lexikalische Semantik)
4 grundlegende Ebenen:
a) lexikalisches Geschlecht
b) die gesellschaftlich geltenden Gendervorstellungen
c) das semantische Geschlecht (Bedeutungsmerkmale von Sprachzeichen)
d) das grammatische Geschlecht (Genus)
a+b betreffen außersprachliche Erscheinungen
c+d betreffen innersprachliche Unterscheidungen und Kategorien
In diesem Zusammenhang besagt „Genus ist nicht gleich Sexus“, dass ein lexikalisches Genus nicht notwendigerweise auf einen bestimmten Sexus verweist (vgl. Meinecke, S. 10)
Peter ist eine Giraffe.
Unsere Schlange nennen wir Rudi.
7. Generisches versus sexusspezifisches Maskulinum
Generisch meint in der Sprachwissenschaft Bezeichnungen, die in einer Aussage abstrakt auf eine Gattung Bezug nehmen und nicht auf ein konkretes Individuum. Bsp.:
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Der generische Gebrauch eines Substantivs ist eine Gebrauchsgewohnheit, die die Semantik eines Wortes nicht berührt. Bsp.:
Die Föhre ist ein Laubbaum.
Die Föhre unseres Nachbarn wird heute gefällt.
Die lexikalische Bedeutung von Föhre ist in beiden Sätzen gleich. Die Aussage bezieht sich aber einmal auf die Gattung Linde und das andere Mal auf eine konkrete Linde.
1. Diese Lehrerin ist tüchtig.
2. Lehrerinnen sind tüchtig.
3. Lehrer sind tüchtig.
ad 1: Hier ist eine konkrete Lehrerin gemeint.
ad 2: Hier sind weibliche Lehrer im Allgemeinen gemeint (generische Aussage)
ad 2: Hier sind a) entweder alle männlichen Lehrer allgemein gemeint
(generische Aussage, aber keine generische Bedeutung) oder
b) alle Lehrer, unabhängig vom Geschlecht (generische Aussage und generische Bedeutung).
„An dieser Schule unterrichten 100 Lehrer, darunter befinden sich 71 Frauen.“
Hier hat das Nomen „Lehrer“ eine geschlechtsübergreifende Bedeutung. Die Aussage hingegen ist nicht generisch.
Die Unterscheidung zwischen generische Aussage und generischer Bedeutung ist wichtig, führt aber leicht zu Vermischungen. Es wäre daher besser, von genderneutraler oder geschlechterübergreifender lexikalischer Bedeutung zu sprechen, als von generischer.
Ob ein Maskulinum im Singular sinnvoll genderneutral verwendet werden kann, ist immer auch vom Kontext und davon abhängig, wie auf etwas Bezug genommen wird. Wenn ein Mann seiner Ehefrau erklärt: „Heute Abend gehe ich mit einem Kollegen zum Essen“, wird die Bezeichnung „Kollege“ bewusst irreführend „genderneutral“ verwendet, wenn es sich beim Kollegen um eine Frau handelt. Dabei erscheint die Assoziation „Kollege“ mit Mann naheliegend, weil wir uns keine geschlechtslose Einzelperson vorstellen können.

Bei manchen Aussagen wie: "Ich gehe mit einem Kollegen
essen" kann das Geschlecht des "Kollegen" von zentralter
Bedeutung sein.
Für Bezeichnungen im Plural schwächen sich die Assoziationen mit einem bestimmten Geschlecht merklich ab. Dies zeigt sich interessanter Weise besonders deutlich im Englischen, wo das Genus nur im Singular differenziert wird, während der Plural eine einheitliche Form trägt. (vgl. Meineke, S. 69-74)
Grundsätzlich sind Leser imstande Sätze wie: „Maria ist Tirolerin. Peter auch.“, trotz der nicht korrekten Verwendung, problemlos zu verstehen, indem ergänzend dazu gedacht wird: „Peter ist auch Tiroler“, aber nicht: „Peter ist auch Tiroler und auch eine Frau.“
Für große Teile der Genderlinguistik bezeichnet „Leser“ männliche und „Leserin“ weibliche Personen. Dabei wird die Fragen falsch herumgestellt, weil sie einen allgemein belegten Sprachgebrauch ignoriert. Sie arbeitet sich stattdessen an den Folgen ab, die durch eine feministische Missdeutung des Genus erst entstanden ist. (vgl. Meineke, S. 83)
So ist der Satz: „Die meisten Leser von Jane Austen sind Frauen.“ logisch verständlich.
Dagegen ist der Satz: „Die wenigsten Leserinnen von Jane Austen sind Männer.“ sinnlos. (vgl. Meinecke, S. 89)
Die Vertreter eine Genderlinguistik setzen Genus und Sexus gleich. Sie vertreten die Ansicht, dass männliche Individuen durch das Genus des Substantivs ausdrücklich genannt werden und damit überrepräsentiert sind, während weibliche Individuen ungenannt bleiben. Die beiden Kategorien Genus und Sexus sind jedoch nicht deckungsgleich: Eigenschaften von Wörtern (z.B. Genus) sind nicht Eigenschaften von Menschen (Sexus oder Gender). Doppeldeutigkeit gehört zu einem allgemeinen Phänomen von Sprache und ist nichts Außergewöhnliches. Fast alle Wörter sind mehrdeutig, weil sonst Sprache nicht das effektive Kommunikationsmittel wäre, das es ist. (vgl.Stathi, S. 9)
8. Generisches Maskulinum und generische Kontexte
Wenn das Merkmal Geschlecht für einen Sachverhalt unwichtig ist, wird die Information sprachlich ausgeblendet. Es gibt aber Kontexte, in denen das Merkmal Geschlecht von Bedeutung ist und das entsprechende Substantiv gewählt werden muss.
Das generische Maskulinum, die unmarkierte Form, wird also in generischen und nicht-spezifischen Kontexten verwendet, weil hier das Geschlecht nicht relevant ist.

Generischen Aussagen wie "Stop" und "Gehen" bei
Ampeln beanspruchen, unabhängig von den bildlichen
Darstellungen, über alle Geschlechter hinweg Gültigkeit.
Von Seiten der Genderlinguistik wird dennoch behauptet, dass die generische Form nur Männer meine, während Frauen, nicht sichtbar und nur mitgemeint seien. Darauf begründet sich die Forderung beide Geschlechter zu nennen. (vgl. Stathi, S. 10)
„Wir suchen einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin.“
„Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind verständnisvoll.“
Auch wenn diese Anwendung grundsätzlich nicht falsch ist, so ist sie doch redundant, wenn bei den Aussagen dem Geschlecht keine Bedeutung zukommt. Spielt das Geschlecht eine wichtige Rolle, müsste explizit darauf hingewiesen werden:
„Wir suchen einen neuen männlichen Mitarbeiter.“
„Unsere Lehrerinnen sind verständnisvoll.“
Außerdem würde diese Sichtweise in den Raum stellen, dass Inhalte nur dann kommuniziert werden, wenn sie auch explizit zur Sprache kommen. In der Realität herrscht in der Kommunikation immer ein Gleichgewicht zwischen Explizitheit und Ökonomie. Der Mehraufwand für größere Genauigkeit muss einen inhaltlichen Mehrwert haben.
Bei generischen Aussagen kommt dem komplexeren Ausdruck „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ inhaltlich kein Mehrwert zu. Bei der Interpretation von Aussagen übernimmt die Pragmatik das, was die Grammatik nicht explizit kodiert. Zur Pragmatik gehören der Äußerungstext, der situative oder kommunikative Kontext und das jeweilige Weltwissen.
Bei einer Doppelnennung wird das Maskulinum automatisch ausschließlich als männlich interpretiert, weil es in Opposition zur weiblichen Form gestellt wird. Wenn diese Strategie ständig verwendet wird, geht langfristig die Doppeldeutigkeit des Maskulinums und damit die Möglichkeit generischer Aussagen verloren. (vgl. Stathi, S. 10)
9. Sprachtests als Argument für gendergerechte Sprache?
In der Genderlinguistik gibt es traditionell eine Verwechslung von Grammatik und lexikalischer Semantik, was sich auch in der Bezeichnung „pseudogenerisch“ für genderneutrale Maskulina zeigt.
Eine Geschlechtssuggestion ist bei Epikoina aufgrund des Genus bei singularischer Verwendung immer zu erwarten, ganz besonders bei Maskulina, zu denen es movierte Feminina, also spezifizierte weibliche Formen wie z.B. Lehrer – Lehrerin gibt. Es fällt daher bei Tests nicht schwer, bei diesen Maskulina bei singulärer und spezifischer Referenz „männliche Assoziationen“ festzustellen und die grammatisch getriggerte Suggestion für die lexikalische Bedeutung auszugeben.
Eine Frage wie: „Denken sie beim Nomen »Lehrer« an eine weibliche oder männliche Person?“ löst sofort die Gegensatzassoziation „entweder oder“ aus. Damit wird die Bezeichnung „Lehrer“ in einen geschlechtsspezifischen Kontext gestellt, was die wissenschaftliche und politische Diskussion verzerrt. Der feministischen Diskussion und ihrer politischen Instrumentalisierung liegt ein Missverständnis von lexikalischer Bedeutung und Genus, von Kognition und Assoziation zugrunde. Ein Verweis auf grammatisch getriggerte Assoziationen in einer Genus-Sprache ist wegen ihrer Unausweichlichkeit trivial und kann daher nicht gegen die Kognition und die Ebene lexikalischer Bedeutung ausgespielt werden. (vgl. Meinecke, S. 49 f)

Ergebnisse von Sprachtests gelten in der feministischen
Linguistik als Hauptargument dafür, die deutsche Sprache
als "Männersprache" mit grundsätzlich diskriminierender
Struktur aufzufassen.
>> Das genderneutrale Maskulinum: Sprachökonomie im ideologischen Spannungsfeld - Teil 1
>> Das genderneutrale Maskulinum: Sprachökonomie im ideologischen Spannungsfeld - Teil 3
Weiterführenden Links:
- Linguistik vs. Gendern: Gendersprache-Vermeidungsgesetz WDR. Anhörung des Ausschusses für Kultur und Medien am 2. März 2023. Schriftliche Stellungnahme Prof. Dr. Katerina Stathi
- Lesen in Tirol: Eckhard Meineke, Studien zum genderneutralen Maskulinum
- Informationsethik: Über die „Studien zum genderneutralen Maskulinum“ von Eckhard Meineke
- Telepolis: Studie zum Gendern: Deutliche Worte, klare Fakten, wohldosierte Emotion
- Netzwerk Bibel und Bekenntnis: Offener Brief an die theologischen Ausbildungsstätten des deutschsprachigen Raums: Einspruch gegen die Nötigung zur Verwendung sog. „geschlechtergerechter Sprache“
- Handbuch geschlechtergerechte Sprache (Leseprobe)
Andreas Markt-Huter, 26-05-2025
