Wolfgang Hermann, Das japanische Fährtenbuch
 Von Kindheit an sind Leser Fährtensucher und Fährtenleser, Abenteuer sind nur zu bestehen, wenn man Spuren lesen kann. Und auch später gehen die Leser immer noch Fährten nach, um sich im Erlebnisdschungel der Welt jenseits aller Digitalisierung mit den eigenen Sinnesorganen zurechtzufinden.
Von Kindheit an sind Leser Fährtensucher und Fährtenleser, Abenteuer sind nur zu bestehen, wenn man Spuren lesen kann. Und auch später gehen die Leser immer noch Fährten nach, um sich im Erlebnisdschungel der Welt jenseits aller Digitalisierung mit den eigenen Sinnesorganen zurechtzufinden.
Wolfgang Hermann bringt den Zustand des Schriftsteller-Seins mit Energie, Durchhaltevermögen, Sturheit, aber auch Beschränktheit, Blindheit, Verbissenheit in Verbindung. (85) Vollends gefordert ist er, wenn er sich durch eine fremde Kultur schlängeln muss, auf Wegen, die noch gar nicht existieren.

 Wer eine Sprache lernt, obwohl er angeblich schon eine hat, kann bereits den Lernvorgang beschreiben. Bei der Erstsprache hingegen muss man alles nehmen, wie es kommt.
Wer eine Sprache lernt, obwohl er angeblich schon eine hat, kann bereits den Lernvorgang beschreiben. Bei der Erstsprache hingegen muss man alles nehmen, wie es kommt. Der Titel Ferngespräch löst sofort Neugierde und Fernweh aus und macht ein weites Lesefeld auf, denn wie oft liest unsereins schon einen Band mit chilenischen Stories.
Der Titel Ferngespräch löst sofort Neugierde und Fernweh aus und macht ein weites Lesefeld auf, denn wie oft liest unsereins schon einen Band mit chilenischen Stories. Frei komponierte Romane haben für den Leser den Vorteil, dass sie auf unterschiedliche Weise gelesen werden können und der Leser mit seiner Sichtweise immer recht hat. Diese offene Erzählform gibt letztlich nur ein paar Laserstrahlen vor, an denen bei jedem Lesevorgang die Episoden neu ausgerichtet werden müssen.
Frei komponierte Romane haben für den Leser den Vorteil, dass sie auf unterschiedliche Weise gelesen werden können und der Leser mit seiner Sichtweise immer recht hat. Diese offene Erzählform gibt letztlich nur ein paar Laserstrahlen vor, an denen bei jedem Lesevorgang die Episoden neu ausgerichtet werden müssen. „Das Jahr 493 begann schlecht für die Einwohner Ravennas. Die Stadt war von der Außenwelt abgeschnitten. Lebensmittel waren kaum noch aufzutreiben und für viele unerschwinglich geworden, man hatte begonnen, alles zu essen, was sich kauen ließ, selbst Unkraut und Leder. […] Der Grund für diese Not war der Krieg, den die Könige Odovakar und Theoderich um die Herrschaft in Italien gegeneinander führten.“ (S. 15)
„Das Jahr 493 begann schlecht für die Einwohner Ravennas. Die Stadt war von der Außenwelt abgeschnitten. Lebensmittel waren kaum noch aufzutreiben und für viele unerschwinglich geworden, man hatte begonnen, alles zu essen, was sich kauen ließ, selbst Unkraut und Leder. […] Der Grund für diese Not war der Krieg, den die Könige Odovakar und Theoderich um die Herrschaft in Italien gegeneinander führten.“ (S. 15) Auf den alten Postkarten und mittlerweile im Netz gibt es diese Kurznachrichten, wo ein komplizierter Zustand auf einen Kurzsatz zusammengestutzt wird. „Aussichten sind überschätzt!“
Auf den alten Postkarten und mittlerweile im Netz gibt es diese Kurznachrichten, wo ein komplizierter Zustand auf einen Kurzsatz zusammengestutzt wird. „Aussichten sind überschätzt!“ „Wer will heute noch über das Recht diskutieren, Argumente auf ihre Prämissen überprüfen, Lebenszeit verausgaben, um nach Gründen für Recht und nach Gründen des Rechts zu suchen. Vom Recht ist nicht mehr die Rede, alle Welt ist nur noch an Gesetzen, Richtlinien, Verordnungen, Erlässen, Bescheiden, Urteilen und Weisungen interessiert. Es gibt keine Vorstellung von der notwendigen Differenz zwischen Ideal und Praxis.“ (S. 7)
„Wer will heute noch über das Recht diskutieren, Argumente auf ihre Prämissen überprüfen, Lebenszeit verausgaben, um nach Gründen für Recht und nach Gründen des Rechts zu suchen. Vom Recht ist nicht mehr die Rede, alle Welt ist nur noch an Gesetzen, Richtlinien, Verordnungen, Erlässen, Bescheiden, Urteilen und Weisungen interessiert. Es gibt keine Vorstellung von der notwendigen Differenz zwischen Ideal und Praxis.“ (S. 7)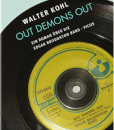 So um 1980 herum haben die damals sechzigjährigen Autoren in ihren aktuellen Romanen wie verrückt ihren Vater gesucht. Momentan versuchen die jetzt sechzigjährigen Kunden des Beats und der psychodelischen Musik mit ihren Bands von damals ins Reine zu kommen. Wahrscheinlich ist das nur eine andere Art von Vatersuche.
So um 1980 herum haben die damals sechzigjährigen Autoren in ihren aktuellen Romanen wie verrückt ihren Vater gesucht. Momentan versuchen die jetzt sechzigjährigen Kunden des Beats und der psychodelischen Musik mit ihren Bands von damals ins Reine zu kommen. Wahrscheinlich ist das nur eine andere Art von Vatersuche.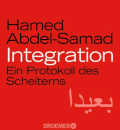 „Überspitzt formuliert könnte man sagen: Nach all den Bemühungen, Konferenzen und Integrationsprojekten, sind vor allem der politische Islam und die Kultur des Patriarchats in Deutschland gut integriert, und das mit staatlicher und kirchlicher Unterstützung.“ (S. 18)
„Überspitzt formuliert könnte man sagen: Nach all den Bemühungen, Konferenzen und Integrationsprojekten, sind vor allem der politische Islam und die Kultur des Patriarchats in Deutschland gut integriert, und das mit staatlicher und kirchlicher Unterstützung.“ (S. 18) Der klassische Städtetourismus gelangt immer mehr an seine Grenzen. Die Trampelpfade sind oft so verstopft, dass man Periskope ausfahren muss, will man jene Sehenswürdigkeiten sehen, die man ohnehin besser auf Wikipedia nachschlägt. Und der Mix an Sehenswürdigkeiten und Geschäften ist so international, dass man alle Strümpfe dieser Welt gesehen hat, wenn man in ein Strumpfgeschäft geht, und alle Museen der Welt kennt, wenn man eines dieser neuen Einheitsmuseen betreten hat.
Der klassische Städtetourismus gelangt immer mehr an seine Grenzen. Die Trampelpfade sind oft so verstopft, dass man Periskope ausfahren muss, will man jene Sehenswürdigkeiten sehen, die man ohnehin besser auf Wikipedia nachschlägt. Und der Mix an Sehenswürdigkeiten und Geschäften ist so international, dass man alle Strümpfe dieser Welt gesehen hat, wenn man in ein Strumpfgeschäft geht, und alle Museen der Welt kennt, wenn man eines dieser neuen Einheitsmuseen betreten hat.