Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert
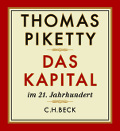 „Dennoch glaube ich, dass Forscher aus den Sozialwissenschaften wie allen anderen Disziplinen, Journalisten und Kommentatoren sämtlicher Medien, Gewerkschaftler und politische Aktivisten aller Richtungen, und vor allem sämtliche Bürger ernsthaft über Geld nachdenken sollten […]. Diejenigen, die viel davon haben, werden gewiss nicht vergessen, ihre Interessen zu verteidigen. Von den Zahlen nichts wissen zu wollen, dient selten der Sache der Ärmsten.“ (793)
„Dennoch glaube ich, dass Forscher aus den Sozialwissenschaften wie allen anderen Disziplinen, Journalisten und Kommentatoren sämtlicher Medien, Gewerkschaftler und politische Aktivisten aller Richtungen, und vor allem sämtliche Bürger ernsthaft über Geld nachdenken sollten […]. Diejenigen, die viel davon haben, werden gewiss nicht vergessen, ihre Interessen zu verteidigen. Von den Zahlen nichts wissen zu wollen, dient selten der Sache der Ärmsten.“ (793)
„Das Kapital im 21. Jahrhundert“ bietet wirtschafts-historische Erklärungen für Erfahrungen, die ein großer Teil der Bevölkerung bereits seit längerer Zeit selbst unmittelbar spüren kann: Die finanziellen Möglichkeiten der breiten Schicht der Bevölkerung werden zunehmend geringer, die Einkommensschere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander.

 Städte historischer Verdichtung sind immer auch mit Gewalt konfrontiert. Die ukrainische Stadt Lviv ist im letzten Jahrhundert stets auch ein Ort brachialer Vernichtung gewesen, so dass man Übersetzungen aus dieser Stadt gerne etwas abmildert. Aus dem „Tango des Todes“ ist im Deutschen jetzt das Proust-sachte „Im Schatten der Mohnblüte“ geworden.
Städte historischer Verdichtung sind immer auch mit Gewalt konfrontiert. Die ukrainische Stadt Lviv ist im letzten Jahrhundert stets auch ein Ort brachialer Vernichtung gewesen, so dass man Übersetzungen aus dieser Stadt gerne etwas abmildert. Aus dem „Tango des Todes“ ist im Deutschen jetzt das Proust-sachte „Im Schatten der Mohnblüte“ geworden. Nur selten gelingt es einem Helden, das abgehangene Spätlebensalter als geerdetes Kind auf einem Traktor zu verbringen und dabei die Leser zu verzücken.
Nur selten gelingt es einem Helden, das abgehangene Spätlebensalter als geerdetes Kind auf einem Traktor zu verbringen und dabei die Leser zu verzücken. Die Welt ist alles, was der Fallwind ist, sagt ein kauziger Typ über die Alpen, deren Haupt-Merkmal vielleicht der Föhn ist. Und egal wo Nord- oder Südtirol tagsüber politisch hin driften, nächtens fließt der Föhn und kratzt die Bewohner auf und bringt sie in Wallung.
Die Welt ist alles, was der Fallwind ist, sagt ein kauziger Typ über die Alpen, deren Haupt-Merkmal vielleicht der Föhn ist. Und egal wo Nord- oder Südtirol tagsüber politisch hin driften, nächtens fließt der Föhn und kratzt die Bewohner auf und bringt sie in Wallung.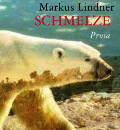 Bei der Schmelze verändert sich der Stoff und geht vom festen in den flüssigen Aggregatszustand über. Auch in der Poesie gibt es so etwas wie Schmelze, wenn sich ein Stoff während des Erzählens verändert und als Prosa-Lava über die Seiten fließt.
Bei der Schmelze verändert sich der Stoff und geht vom festen in den flüssigen Aggregatszustand über. Auch in der Poesie gibt es so etwas wie Schmelze, wenn sich ein Stoff während des Erzählens verändert und als Prosa-Lava über die Seiten fließt.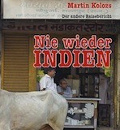 So wie man eine Reise antritt, so wird sie auch ausfallen. Am aufmerksamsten reist, wer eine Reise nur einmal machen möchte.
So wie man eine Reise antritt, so wird sie auch ausfallen. Am aufmerksamsten reist, wer eine Reise nur einmal machen möchte.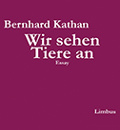 Wenn Tiere mehr als eine Sache aber weniger als ein Mensch sind, muss folglich auch unser Blick auf sie heftiger als auf Sachen aber weniger intensiv als auf Menschen ausfallen.
Wenn Tiere mehr als eine Sache aber weniger als ein Mensch sind, muss folglich auch unser Blick auf sie heftiger als auf Sachen aber weniger intensiv als auf Menschen ausfallen.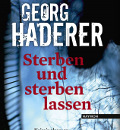 In den wirklich schweren Fällen des Krimi-Daseins ist das Komplizierteste und Unverständlichste der Kommissar selbst, der durch seine bloße Existenz alles düster und unausstehlich macht.
In den wirklich schweren Fällen des Krimi-Daseins ist das Komplizierteste und Unverständlichste der Kommissar selbst, der durch seine bloße Existenz alles düster und unausstehlich macht.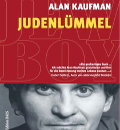 Spätestens seit Woody Allen ducken wir europäischen Nachfahren der Hitler-Herrschaft immer wieder zusammen, wenn wir hören, wie sich der jüdische Witz oft gegen die jüdischen Witzeerzähler selbst richtet und dabei schonungslos Muster freilegt, die sich nur mit dem Witz überwinden lassen.
Spätestens seit Woody Allen ducken wir europäischen Nachfahren der Hitler-Herrschaft immer wieder zusammen, wenn wir hören, wie sich der jüdische Witz oft gegen die jüdischen Witzeerzähler selbst richtet und dabei schonungslos Muster freilegt, die sich nur mit dem Witz überwinden lassen.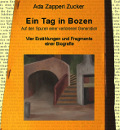 Am eindringlichsten lassen sich Orte porträtieren, wenn Heldinnen und Helden als Fremde von diesen sozialen Gebilden angenommen oder abgestoßen werden. Die Protagonisten vereinen dabei in ihrer kombinierten Innen- und Außensicht fixe Eindrücke der Einheimischen mit elastischen Gedankengängen aus anderen Kulturen.
Am eindringlichsten lassen sich Orte porträtieren, wenn Heldinnen und Helden als Fremde von diesen sozialen Gebilden angenommen oder abgestoßen werden. Die Protagonisten vereinen dabei in ihrer kombinierten Innen- und Außensicht fixe Eindrücke der Einheimischen mit elastischen Gedankengängen aus anderen Kulturen.