Peter Natter, Die Tote im Cellokasten
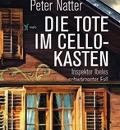 Wenn es Leute gibt, die bei der Schubertiade im Bregenzer Wald vor Hingabe zerschmelzen, wird es auch genügend Fans geben, die sich bei der Lektüre eines Wälder-Krimis vor Wonne quasi selbst auflösen.
Wenn es Leute gibt, die bei der Schubertiade im Bregenzer Wald vor Hingabe zerschmelzen, wird es auch genügend Fans geben, die sich bei der Lektüre eines Wälder-Krimis vor Wonne quasi selbst auflösen.
Peter Natter, der wie alle Krimi-Schreiber die Produktion von Krimis freiwillig macht, schickt seinen skurrilen Bregenzer Inspektor Ibele zu einem Fall, der während der Schubertiade in Schwarzenberg loslegt, weshalb es auch gleich Ibeles schwärzester Fall wird.

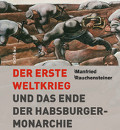 „Österreich-Ungarn aber, eine – wie es so schön hieß – »stagnierende Großmacht«, sah ähnlich wie Großbritannien in der Aufrechterhaltung der geltenden europäischen Ordnung eine Chance. Das aber nicht aus innerster Überzeugung, sondern aufgrund einer evidenten Schwäche. Sie, und vor allem sie war der Grund dafür, dass Krieg zur Lösung der Probleme dann doch wenn schon nicht angestrebt, so nicht mehr regelrecht ausgeschlossen wurde.“ (14)
„Österreich-Ungarn aber, eine – wie es so schön hieß – »stagnierende Großmacht«, sah ähnlich wie Großbritannien in der Aufrechterhaltung der geltenden europäischen Ordnung eine Chance. Das aber nicht aus innerster Überzeugung, sondern aufgrund einer evidenten Schwäche. Sie, und vor allem sie war der Grund dafür, dass Krieg zur Lösung der Probleme dann doch wenn schon nicht angestrebt, so nicht mehr regelrecht ausgeschlossen wurde.“ (14) Empfindsame Seelen müssen geschützt in abgedunkelter Atmosphäre gehalten werden, nur im Schutz der eigenen Umhüllung können sie manche Tage überstehen.
Empfindsame Seelen müssen geschützt in abgedunkelter Atmosphäre gehalten werden, nur im Schutz der eigenen Umhüllung können sie manche Tage überstehen.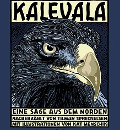 „Wo bist du gewesen? Im Norden, sagte Väinämoinen, in Pohjolo, wo die Hexe Louhi herrscht. Aber wusstest du, dass sie eine wunderschöne Tochter hat, so reizend wie ihre Mutter hässlich ist? Das Mädchen soll denjenigen heiraten, der für Louhi das Sampo schmiedet.“ (46)
„Wo bist du gewesen? Im Norden, sagte Väinämoinen, in Pohjolo, wo die Hexe Louhi herrscht. Aber wusstest du, dass sie eine wunderschöne Tochter hat, so reizend wie ihre Mutter hässlich ist? Das Mädchen soll denjenigen heiraten, der für Louhi das Sampo schmiedet.“ (46)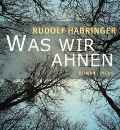 Sensible Menschen verlassen sich nicht so sehr auf das Sichtbare und Ausgesprochene, sie knüpfen sich auch die Aura und das Unantastbare vor, wenn sie mit anderen in Kontakt treten. Das Leben ist schließlich an manchen Tagen nichts Gewisses sondern bloß eine Ahnung von allem, was uns umgibt.
Sensible Menschen verlassen sich nicht so sehr auf das Sichtbare und Ausgesprochene, sie knüpfen sich auch die Aura und das Unantastbare vor, wenn sie mit anderen in Kontakt treten. Das Leben ist schließlich an manchen Tagen nichts Gewisses sondern bloß eine Ahnung von allem, was uns umgibt. Das Druckwesen hat zur Entwicklung der Gesellschaft mindestens so viel beigetragen wie die Adelsgeschlechter zusammen, daher gebührt es einer guten Druckerei, dass sie zwischendurch epochal dargestellt wird.
Das Druckwesen hat zur Entwicklung der Gesellschaft mindestens so viel beigetragen wie die Adelsgeschlechter zusammen, daher gebührt es einer guten Druckerei, dass sie zwischendurch epochal dargestellt wird. Wenn ein Wort semantisch wild genug ist, kann es das gesamte Universum darstellen.
Wenn ein Wort semantisch wild genug ist, kann es das gesamte Universum darstellen. Island gilt allenthalben als dermaßen einmalig, dass es davon nicht einmal ein Kitsch-Fassung gibt. Was immer man auch über Island sagt, es stimmt, denn es ist an manchen Tagen nicht von dieser Welt.
Island gilt allenthalben als dermaßen einmalig, dass es davon nicht einmal ein Kitsch-Fassung gibt. Was immer man auch über Island sagt, es stimmt, denn es ist an manchen Tagen nicht von dieser Welt. Wenn ein Thema ein Leben lang tierisch ernst behandelt wird wie der Kosmos Krankheit, löst schon die Aussicht, dass darüber Satiren und Grotesken verfasst werden, erwartungsvolles Gelächter aus.
Wenn ein Thema ein Leben lang tierisch ernst behandelt wird wie der Kosmos Krankheit, löst schon die Aussicht, dass darüber Satiren und Grotesken verfasst werden, erwartungsvolles Gelächter aus. Ein Schriftsteller hat seinen geheimen Auftrag vermutlich dann erreicht, wenn er in seinem Werk unverwechselbar erkennbar ist, was oft mit der Ausarbeitung einer eigenen Literaturgattung einhergeht.
Ein Schriftsteller hat seinen geheimen Auftrag vermutlich dann erreicht, wenn er in seinem Werk unverwechselbar erkennbar ist, was oft mit der Ausarbeitung einer eigenen Literaturgattung einhergeht.