Arienne Bolt, Die abenteuerliche Reise der Ballerinus
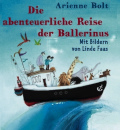 „»Am liebsten würde ich die Tiere dort für immer wegholen. Dann müssten sie nicht in den Käfigen eingeschlossen bleiben und nicht ins Schlachthaus! Wenn sie in den Ruhestand gehen, so wie du, verdienen sie auch ein gutes Zuhause.« (S. 53)
„»Am liebsten würde ich die Tiere dort für immer wegholen. Dann müssten sie nicht in den Käfigen eingeschlossen bleiben und nicht ins Schlachthaus! Wenn sie in den Ruhestand gehen, so wie du, verdienen sie auch ein gutes Zuhause.« (S. 53)
Seit dem Tod seiner Mutter Luna lebt der junge Ravi in einem alten Wohnwagen an einem Kanal, wo er jeden Tag von Ice besucht wird, ein streunender Hund von dem er nicht weiß, wo er jede Nacht schläft. Es ist der Abend vor seinem Geburtstag, zu dem er von seiner einzigen Verwandten, seiner Tante Lena eine Glückwunschkarte, eine Einladung zu einer Geburtstagstorte und eine Jahres-Eintrittskarte für den Besuch in einem Zoo, von dem Ravi merkwürdigerweise noch nie etwas gehört hat.

 „Österreich wird zum Testfall in Europa, an dem sich zeigen wird, ob am Ende Menschlichkeit, Aufrichtigkeit und Mut in einer lebendigen Demokratie siegen werden. In der Alpenrepublik wird über die Symptome der neuen Unbehaglichkeit heftig gestritten.“ (S. 14)
„Österreich wird zum Testfall in Europa, an dem sich zeigen wird, ob am Ende Menschlichkeit, Aufrichtigkeit und Mut in einer lebendigen Demokratie siegen werden. In der Alpenrepublik wird über die Symptome der neuen Unbehaglichkeit heftig gestritten.“ (S. 14)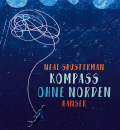 „Zwei Dinge weißt du. Erstens: Du warst da. Zweitens: Du kannst nicht dagewesen sein. Diese unvereinbarten Wahrheiten gleichzeitig festzuhalten, erfordert Jongliergeschick. Natürlich braucht man beim Jonglieren einen dritten Ball, damit der Rhythmus im Fluss bleibt. Dieser dritte Ball ist die Zeit – die viel unbändiger herumspringt, als wir glauben mögen.“ (S. 11)
„Zwei Dinge weißt du. Erstens: Du warst da. Zweitens: Du kannst nicht dagewesen sein. Diese unvereinbarten Wahrheiten gleichzeitig festzuhalten, erfordert Jongliergeschick. Natürlich braucht man beim Jonglieren einen dritten Ball, damit der Rhythmus im Fluss bleibt. Dieser dritte Ball ist die Zeit – die viel unbändiger herumspringt, als wir glauben mögen.“ (S. 11)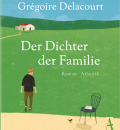 Üblicherweise muss ein Dichter von Kindesbeinen an gegen eine feindliche Umwelt kämpfen und alle seriösen Berufsangebote ausschlagen, damit er sein Leben der Literatur opfern kann. werden kann.
Üblicherweise muss ein Dichter von Kindesbeinen an gegen eine feindliche Umwelt kämpfen und alle seriösen Berufsangebote ausschlagen, damit er sein Leben der Literatur opfern kann. werden kann. „Sinemon war schrecklich aufgeregt. In Kürze würde ein kleiner Stern namens Marlou am Firmament auftauchen. Seine vorerst zaghafte Erscheinung würde zu einem hellen Leuchten werden und sein Strahlen das Funkeln am Himmel der Welt bereichern.“ (S. 6)
„Sinemon war schrecklich aufgeregt. In Kürze würde ein kleiner Stern namens Marlou am Firmament auftauchen. Seine vorerst zaghafte Erscheinung würde zu einem hellen Leuchten werden und sein Strahlen das Funkeln am Himmel der Welt bereichern.“ (S. 6)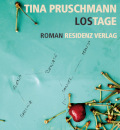 Wem die Natur zu wenig dramatisch ist, der baut in der Landwirtschaft gerne sogenannte Lostage darin ein. Lostage verstärken einen Zustand ins Unermessliche und wirken wie eine Zauberkraft. Wer an Lostagen alles richtigmacht, kann die Natur vielleicht überlisten. So sind Lostage Wünsche und augenzwinkernde Logik in einem.
Wem die Natur zu wenig dramatisch ist, der baut in der Landwirtschaft gerne sogenannte Lostage darin ein. Lostage verstärken einen Zustand ins Unermessliche und wirken wie eine Zauberkraft. Wer an Lostagen alles richtigmacht, kann die Natur vielleicht überlisten. So sind Lostage Wünsche und augenzwinkernde Logik in einem.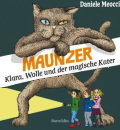 „»Wenn wir nur wüssten, was sie vorhat. »Maunz.« »Ich hoffe, wir können es verhindern. Nur so können wir Minze retten.« »Maunz.« »Okay, ich werde mich einschulen lassen, das ist der einzige Weg.« »Maunz.« Die grüne Jacke vorne eng zusammengezogen, murmelte das Mädchen: »Arme Kinder der 4a Klasse, sie wissen nicht, was auf sie zukommt.«“ (S. 8f)
„»Wenn wir nur wüssten, was sie vorhat. »Maunz.« »Ich hoffe, wir können es verhindern. Nur so können wir Minze retten.« »Maunz.« »Okay, ich werde mich einschulen lassen, das ist der einzige Weg.« »Maunz.« Die grüne Jacke vorne eng zusammengezogen, murmelte das Mädchen: »Arme Kinder der 4a Klasse, sie wissen nicht, was auf sie zukommt.«“ (S. 8f) „Ich begann, den roten Faden zu sehen, der ein Massaker in einem abgelegenen afrikanischen Dorf mit den Freuden und Bequemlichkeiten verbindet, die wir in den reicheren Teilen der Welt genießen. Er zieht sich durch die globalisierte Wirtschaft, von Kriegsgebieten bis zu den Gipfeln von Macht und Reichtum […]. Dieses Buch ist mein Versuch, diesem Faden zu folgen. (S. 11)
„Ich begann, den roten Faden zu sehen, der ein Massaker in einem abgelegenen afrikanischen Dorf mit den Freuden und Bequemlichkeiten verbindet, die wir in den reicheren Teilen der Welt genießen. Er zieht sich durch die globalisierte Wirtschaft, von Kriegsgebieten bis zu den Gipfeln von Macht und Reichtum […]. Dieses Buch ist mein Versuch, diesem Faden zu folgen. (S. 11) „Rotkäppchen trägt einen Korb mit Rotwein und mit Kuchen. »Gib acht vorm Wolf«, rät Mama ihr. Sie geht Großmutter besuchen. Der Wolf eilt vor zur Großmutter, hat einen Plan, hehe. Er scheucht sie aus dem Bett, sie soll sein Essen sein zum Tee!“
„Rotkäppchen trägt einen Korb mit Rotwein und mit Kuchen. »Gib acht vorm Wolf«, rät Mama ihr. Sie geht Großmutter besuchen. Der Wolf eilt vor zur Großmutter, hat einen Plan, hehe. Er scheucht sie aus dem Bett, sie soll sein Essen sein zum Tee!“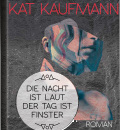 Gigantische Begriffe wie laut und finster lassen sich nur schwer beschreiben, denn jede einzeln beschriebene Teilmenge daraus dämpft ja die Lautstärke oder die Finsternis.
Gigantische Begriffe wie laut und finster lassen sich nur schwer beschreiben, denn jede einzeln beschriebene Teilmenge daraus dämpft ja die Lautstärke oder die Finsternis.