 Die raren Gedichtbände beinahe schon verlorengegangener Lyrik-Helden gleichen unauffälligen Meteoriten: Während Gras über ihren Einschlagkrater wächst, beginnen sie aus der schwarzen Antimaterie heraus zu funkeln.
Die raren Gedichtbände beinahe schon verlorengegangener Lyrik-Helden gleichen unauffälligen Meteoriten: Während Gras über ihren Einschlagkrater wächst, beginnen sie aus der schwarzen Antimaterie heraus zu funkeln.
Neeli Cherkovski, der alte Haudegen aus der kleinen Schar der Ur-Beatniks, hat mit seinem Band „Falling Light“ einen solchen Meteoriten nach Europa gesandt, wo er in der Übersetzung „Fallendes Licht“ im kleinen Zirler Verlag BAES gelandet ist.

 Genau besehen haben Allerweltsgedichte eine doppelte Zugkraft, einmal ziehen sie mit großem Drang hinaus in alle Welt, andererseits sind sie von einer Alltäglichkeit, dass sie auch zu Hause bestens funktionieren.
Genau besehen haben Allerweltsgedichte eine doppelte Zugkraft, einmal ziehen sie mit großem Drang hinaus in alle Welt, andererseits sind sie von einer Alltäglichkeit, dass sie auch zu Hause bestens funktionieren. In der Literaturgeschichte gibt es so magische Kosenamen, die das Herz des Belesenen sofort höher schlagen lassen. Lenz ist so ein poetischer Zauberer, der bei jedem Aufruf an die Grenzen seiner Gedankenkapazität geht, manchmal umringt von einem Gebirge.
In der Literaturgeschichte gibt es so magische Kosenamen, die das Herz des Belesenen sofort höher schlagen lassen. Lenz ist so ein poetischer Zauberer, der bei jedem Aufruf an die Grenzen seiner Gedankenkapazität geht, manchmal umringt von einem Gebirge. Ein Titel wie ein Ohrwurm! Schon vom Umschlag an setzt sich das Gezirpe in das Ohr, man hört beim Blättern vor allem die eigenen Grillen aus allen südlichen Sphären und Sommern der eigenen Biographie.
Ein Titel wie ein Ohrwurm! Schon vom Umschlag an setzt sich das Gezirpe in das Ohr, man hört beim Blättern vor allem die eigenen Grillen aus allen südlichen Sphären und Sommern der eigenen Biographie. Die Geschwindigkeit, mit der ein Ereignis abläuft, hat nichts mit seiner Erwartbarkeit zu tun. So können uns spitze Dinge genauso unerwartet anspringen wie wir über den unheimlichen Verlauf eines langen Vorgangs überrascht sind.
Die Geschwindigkeit, mit der ein Ereignis abläuft, hat nichts mit seiner Erwartbarkeit zu tun. So können uns spitze Dinge genauso unerwartet anspringen wie wir über den unheimlichen Verlauf eines langen Vorgangs überrascht sind.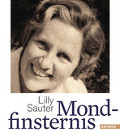 Der hundertste Geburtstag von Dichterinnen und Dichter ist für zeitlose Leser immer ein willkommener Anlass, deren Werk in der aktuellen Verankerung zu überprüfen durch Nachlesen.
Der hundertste Geburtstag von Dichterinnen und Dichter ist für zeitlose Leser immer ein willkommener Anlass, deren Werk in der aktuellen Verankerung zu überprüfen durch Nachlesen. Der Typenschein der „Flugblätter“ sagt es sehr genau: Lyrik kommt an gelungenen Tagen im Flug daher, Gedichte strömen durch die Zeit schwerelos wie die berüchtigten Blätter im Herbst, und eine politische Komponente darf im Zeitalter der Apps ebenfalls angenommen werden, Lyrik bringt zwischendurch auch Botschaften, die früher einmal im Zeitalter einer haptischen Öffentlichkeit über Flugblätter verbreitet worden ist.
Der Typenschein der „Flugblätter“ sagt es sehr genau: Lyrik kommt an gelungenen Tagen im Flug daher, Gedichte strömen durch die Zeit schwerelos wie die berüchtigten Blätter im Herbst, und eine politische Komponente darf im Zeitalter der Apps ebenfalls angenommen werden, Lyrik bringt zwischendurch auch Botschaften, die früher einmal im Zeitalter einer haptischen Öffentlichkeit über Flugblätter verbreitet worden ist. Manchmal nimmt einen die Lyrik gleich mehrfach bei der Hand und verführt einen auf der Hinterseite der Begriffe, an der Unterseite der Überschrift oder einfach an einem Ort außerhalb der Zeit.
Manchmal nimmt einen die Lyrik gleich mehrfach bei der Hand und verführt einen auf der Hinterseite der Begriffe, an der Unterseite der Überschrift oder einfach an einem Ort außerhalb der Zeit. Manche Titel brechen einem schon beim puren Vor-sich-hin-Murmeln das Herz, weil sie es in einer brutalen Silbenfolge so richtig sagen. „Brechen-brach-gebrochen“ erinnert an ungute Situationen, wo jemand vielleicht die Sprache lernen muss, während sie ihm ein anderer einprügelt und dadurch das Rückgrat bricht.
Manche Titel brechen einem schon beim puren Vor-sich-hin-Murmeln das Herz, weil sie es in einer brutalen Silbenfolge so richtig sagen. „Brechen-brach-gebrochen“ erinnert an ungute Situationen, wo jemand vielleicht die Sprache lernen muss, während sie ihm ein anderer einprügelt und dadurch das Rückgrat bricht. In ihren vagen Ausmaßen ist die Schattenzeit etwas, was sich über Herbst und Winter erstrecken kann, im Lebenslauf ist die Schattenzeit eine breite Linie, an der wie bei Joseph Conrad das Bewusstsein in einen anderen Zustand umschlägt.
In ihren vagen Ausmaßen ist die Schattenzeit etwas, was sich über Herbst und Winter erstrecken kann, im Lebenslauf ist die Schattenzeit eine breite Linie, an der wie bei Joseph Conrad das Bewusstsein in einen anderen Zustand umschlägt.