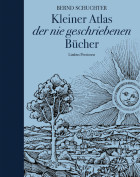 Selbstverständlich erwarten wir in der Geruchskultur, dass Parfum in Flacons abgefüllt ist und nicht im Tetrapack. In der Lesekultur freilich muten wir uns ständig lieblos abgefüllte Massenware zu, die wir in Files herumschicken oder uns als Paperback an den Kopf werfen.
Selbstverständlich erwarten wir in der Geruchskultur, dass Parfum in Flacons abgefüllt ist und nicht im Tetrapack. In der Lesekultur freilich muten wir uns ständig lieblos abgefüllte Massenware zu, die wir in Files herumschicken oder uns als Paperback an den Kopf werfen.
Bernd Schuchter kümmert sich als Verleger darum, die hohe Kunst der Buchkultur wenigstens in raren Exemplaren am Leben zu erhalten. Mit seinem „Atlas der nie geschriebenen Bücher“ geht er zudem der These nach, wonach das Handwerk des Schriftstellers die Fiktion ist. Daraus resultiert auch das Bonmont, dass die sogenannte Literaturgeschichte insgesamt erfunden ist. Im Zeitalter der Fake-News sollte man die Unwahrscheinlichkeit von Geschichten vielleicht Flunkerei nennen, sie ist das Fundament für jede tragfähige Geschichte.
Unter dem majestätischen Begriff des „Atlas“ erzählt der Autor von drei kulturellen Haltungen:
- Die Gestaltung eines Buches ist seine Meta-Erzählung!
Für die Ausgestaltung des Buches werden daher alle Register gezogen, die jüngere Leser nur mehr als selten verwendete Vokabel kennen, Leinenrücken, Buchbändchen, Faksimile, Baskerville und Lektorat. Tatsächlich hat das Lektorat Georg Hasibeder übernommen, der jahrzehntelang mit Hingabe einen klandestinen Verlag geleitet hat.
- Die wahre Botschaft ist seit Jahrhunderten in Fußnoten versteckt!
Gleich zu Beginn im Vorwort leistet sich Bernd Schuchter die einzige Fußnote, darin versteckt er die Botschaft, dass Gendern ein Verbrechen ist, wenn es an alten Texten und historischen Personen geschieht. Sein Beitrag zur Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ist die Auswahl der angesteuerten Biographien, immerhin gelingt es ihm, zurück geblendet auf fünf Jahrhunderte sechs Männer und vier Frauen als Fallbeispiele für verschollene Werke ausfindig zu machen.
- Die besten Geschichten sind jene, die nie zustande gekommen sind!
Diese Überlegung führt stracks hinein in die Dramaturgie der Fabulierungen. Schriftsteller müssen sich ja stets mit dem Paradoxon auseinandersetzen, dass sie mit unwichtigen Werken in die Literaturgeschichte eingehen, während die wichtigen oft nicht realisiert werden oder sonst wie verloren gehen.
Dieses Verschwinden wertvoller Texte im schwarzen Loch der Fiktion lässt den Autor fabulieren. Zwar sind die zitierten Bücher und biographischen Daten der Protagonisten wahr, aber zwischen den überlieferten Zeilen sind jene Geheimnisse versteckt, die man probehalber als Übertreibung aussprechen sollten.
Neben bekannten Schicksalen wie die von Montaigne, Thoreau oder Stefan Zweig sind unbekanntere Biographien wie jene von Mary Shelley, Cyrano de Bergerac oder Olympe de Gouges erzählt.
Allen wird im Atlas die Behauptung zugeschrieben, dass sie wesentliche Teile ihres Werkes mit ins Grab genommen haben. Dabei können diese Verluste für die Literaturgeschichte auf mannigfaltige Weise entstehen.
Montaigne etwa erinnert sich an seinen Freund, der mit der radikalen Behauptung zugrunde gegangen ist, wonach man absolute Herrscher bekämpfen könne, indem man ihnen keinen Respekt erweist. Ohne diesen Zwangsrespekt nämlich sind sie machtlos. Montaigne setzt seine radikalen Thesen daher seinem Freund in den Mund und verweigert sich so den Nachforschungen über sein Werk. Tatsächlich wird er erst nach seinem Tod auf den Index gesetzt, seine Vorsicht hat sich also gelohnt.
An anderer Stelle werden Entwürfe während der Schiffsfahrt im Ozean versenkt, indem seine Autorin lange den Wellen nachschaut, in die sie soeben ihre besten Gedanken verklappt hat.
Olympe de Gouges hingegen versäumt während der französischen Revolution den Absprung auf die richtige Seite, sodass ihr nur mehr die Forderung nach Gleichheit bleibt, wonach auch Frauen ein Recht auf die Guillotine haben. Mit dem Fallbeil verschwinden auch die besten Gedanken aus ihrem Kopf, wie ein Literatur-Fabulierer bedauernd feststellt.
Voltaire schließlich verfasst ein Schmähgedicht über ein absolutistisches Würstchen und muss die Gegend fluchtartig verlassen. Kommilitonen der Literatur bringen sich gerade noch in Sicherheit, indem sie die Existenz des Schmähgedichts leugnen, damit dieses nicht in die Literaturgeschichte hineinfindet.
Die zehn Essays sind jeweils mit Porträt und Werkverzeichnis ausgestattet, jedem ist mindestens ein wesentliches Zitat zugeordnet, das in großer Aufmachung für ein perfektes Lebensmotto ausreicht.
- Die meisten unserer Tätigkeiten sind Possen. (Montaigne)
- Der Pessimist ist jemand, der vorzeitig die Wahrheit erzählt. (Cyrano de Bergerac)
- Täglich saßen wir stundenlang, und nichts entging uns. (Stefan Zweig)
Eine alte Bibliotheksweisheit spricht davon, dass sich gute Bücher haptisch über die Hände und Arme auf den Kreislauf der Leser ausbreiten. – Den sogenannten „Schuchter-Atlas“ sollte man also mit beiden Händen fassen, darin blättern, lesen, und sich flanierend treiben lassen.
Bernd Schuchter, Kleiner Atlas der nie geschriebenen Bücher. Fabulierungen
Innsbruck: Limbus Verlag 2025, 176 Seiten, 26,00 €, ISBN 978-3-99039-274-4
Weiterführende Links:
Limbus Verlag: Bernd Schuchter, Kleiner Atlas der nie geschriebenen Bücher
Wikipedia: Bernd Schuchter
Helmuth Schönauer, 28-08-2025
