Waltraud Mittich, Micòl
 Eine besonders professionelle Form einer Roman-Struktur besteht im Nacherzählen, Umschreiben und persönlichen Infiltrieren eines anerkannten Textes. 1962 ist der Roman „Die Gärten der Finzi Contini“ von Giorgio Bassani erschienen, 1975 kommt die Verfilmung durch Vittorio De Sica.
Eine besonders professionelle Form einer Roman-Struktur besteht im Nacherzählen, Umschreiben und persönlichen Infiltrieren eines anerkannten Textes. 1962 ist der Roman „Die Gärten der Finzi Contini“ von Giorgio Bassani erschienen, 1975 kommt die Verfilmung durch Vittorio De Sica.
Buch und Film fesseln Waltraud Mittich sofort und lassen sie ein Leben lang nicht mehr los. Jetzt hat sie eine Figur der Gartenszenerie, nämlich das überlebende jüdische Mädchen Micòl, mit einem anderen Schicksal versehen und sie als kämpfende, selbstbewusste Frau durch das Nachkriegseuropa geschickt.

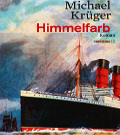 Scheinbar unverfängliche Themen machen explosionsartig auf und zeigen eine Riesenwunde der Zeitgeschichte, wenn man sie mit vorsichtigem Erzählbesteck serviert.
Scheinbar unverfängliche Themen machen explosionsartig auf und zeigen eine Riesenwunde der Zeitgeschichte, wenn man sie mit vorsichtigem Erzählbesteck serviert.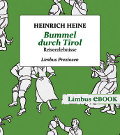 Wenn eine Berühmtheit etwas sagt, können auch sogenannte blöde Sätze äußerst wertvoll werden. Der Sager „Innsbruck selbst ist eine unwohnliche, blöde Stadt“ wird zwar für richtig gehalten und tausendmal am Tag ausgesprochen, aber erst dass dieser Satz von Heinrich Heine stammt, macht ihn so wertvoll.
Wenn eine Berühmtheit etwas sagt, können auch sogenannte blöde Sätze äußerst wertvoll werden. Der Sager „Innsbruck selbst ist eine unwohnliche, blöde Stadt“ wird zwar für richtig gehalten und tausendmal am Tag ausgesprochen, aber erst dass dieser Satz von Heinrich Heine stammt, macht ihn so wertvoll.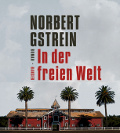 In den guten multiplen Romanen gibt es so viele Lesemöglichkeiten, dass zwei Leser im Gespräch darüber oft eine Zeitlang brauchen, um zu kapieren, dass sie den gleichen Roman gelesen haben.
In den guten multiplen Romanen gibt es so viele Lesemöglichkeiten, dass zwei Leser im Gespräch darüber oft eine Zeitlang brauchen, um zu kapieren, dass sie den gleichen Roman gelesen haben.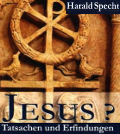 „Hat Jesus jemals gelebt? Oder ist er nur ein Phantom. »War Jesus doch nur eine Erfindung der urchristlichen Gemeinde?«, fragt Augstein. Eine erdichtete Figur, ausgesponnen von frühen Christen und Kirchenmännern? Kann man diese Frage heute noch klären? Gibt es von Jesus überhaupt noch greifbare Spuren in der Geschichte?“ (18)
„Hat Jesus jemals gelebt? Oder ist er nur ein Phantom. »War Jesus doch nur eine Erfindung der urchristlichen Gemeinde?«, fragt Augstein. Eine erdichtete Figur, ausgesponnen von frühen Christen und Kirchenmännern? Kann man diese Frage heute noch klären? Gibt es von Jesus überhaupt noch greifbare Spuren in der Geschichte?“ (18)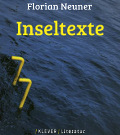 Inseltexte sind eine beinahe magische Gattungsbezeichnung für einen Inhalt, der vielleicht zwischen Insel der Seligen und Mullinsel aufgestellt ist.
Inseltexte sind eine beinahe magische Gattungsbezeichnung für einen Inhalt, der vielleicht zwischen Insel der Seligen und Mullinsel aufgestellt ist. Zu den verwerflichsten Dingen gehört die Rekrutierung von Kindern für ein diffuses politisches Ziel. Was man heute diversen Terrorgruppen vorwirft, hat bis vor kurzem noch die Kirche perfekt abgewickelt.
Zu den verwerflichsten Dingen gehört die Rekrutierung von Kindern für ein diffuses politisches Ziel. Was man heute diversen Terrorgruppen vorwirft, hat bis vor kurzem noch die Kirche perfekt abgewickelt. „Als Donald Trump im Juni 2015 auf der Rolltreppe in das Atrium des Trump Tower herabschwebte, um bekannt zu geben, dass er bei den Präsidentschaftswahlen antreten würde, live übertragen von den nationalen Fernsehsendern, hielten fast alle Journalisten seine Kandidatur für ein reines Eitelkeitsprojekt. Ich nicht.“ (9)
„Als Donald Trump im Juni 2015 auf der Rolltreppe in das Atrium des Trump Tower herabschwebte, um bekannt zu geben, dass er bei den Präsidentschaftswahlen antreten würde, live übertragen von den nationalen Fernsehsendern, hielten fast alle Journalisten seine Kandidatur für ein reines Eitelkeitsprojekt. Ich nicht.“ (9)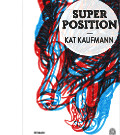 Wer eine Superposition einnimmt, hat es sportlich, gesellschaftlich oder sexuell geschafft. Der Begriff zieht durchaus den Neid an und wird zum Selbstschutz der Helden deshalb oft ironisch verwendet. Jemand mit der Arschkarte in der Hand kann also durchaus verkünden, dass er eine Superposition habe.
Wer eine Superposition einnimmt, hat es sportlich, gesellschaftlich oder sexuell geschafft. Der Begriff zieht durchaus den Neid an und wird zum Selbstschutz der Helden deshalb oft ironisch verwendet. Jemand mit der Arschkarte in der Hand kann also durchaus verkünden, dass er eine Superposition habe. Ein guter Titel wird unumstößlich wahr, wenn er sich an physikalische Grundgesetze hält. 8 Minuten und 19 Sekunden braucht das Licht, um von der Sonne auf die Erde zu gelangen, wir sind also mit jedem Sonnenstrahl dieser Zeitangabe ausgesetzt.
Ein guter Titel wird unumstößlich wahr, wenn er sich an physikalische Grundgesetze hält. 8 Minuten und 19 Sekunden braucht das Licht, um von der Sonne auf die Erde zu gelangen, wir sind also mit jedem Sonnenstrahl dieser Zeitangabe ausgesetzt.