Franz Friedrich Altmann, Turrinis Jagd
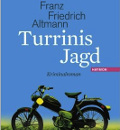 Das Wichtigste an einem Roman ist oft das vorangesetzte Motto, oft schreiben Autoren nur einen Roman, um das Motto ins rechte Licht zu rücken.
Das Wichtigste an einem Roman ist oft das vorangesetzte Motto, oft schreiben Autoren nur einen Roman, um das Motto ins rechte Licht zu rücken.
Franz Friedrich Altmann nimmt naturgemäß als Kabarettist und Fun-Dramaturg die Sache mit dem Provinzkrimi recht ernst und beugt sich zum Publikum hinunter wie zu einem kleinen Kind, wenn er die Schlägereien, Fressereien und tierischen Kopulationen des Mühlviertels beschreibt. Aus dieser Haltung heraus ist auch das Motto zu verstehen: „Für den kleinen Emilian, der noch gar nicht lesen kann.“

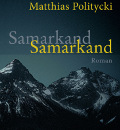 Manche Titel verströmen Magie und wirken wie eine Zauberformel. „Samarkand Samarkand“ reißt den Leser quasi durch den Umschlag in den Text hinein.
Manche Titel verströmen Magie und wirken wie eine Zauberformel. „Samarkand Samarkand“ reißt den Leser quasi durch den Umschlag in den Text hinein.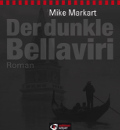 Wenn eine große Verstörung vorliegt, verordnen Ärzte manchmal Spaziergänge oder den bloßen Aufenthalt im Freien. In der Literatur entsteht aus diesen Genesungs-Aufenthalten der Helden oft ein gesunder Roman.
Wenn eine große Verstörung vorliegt, verordnen Ärzte manchmal Spaziergänge oder den bloßen Aufenthalt im Freien. In der Literatur entsteht aus diesen Genesungs-Aufenthalten der Helden oft ein gesunder Roman. Wenn eine Autorin für ihre Figuren verantwortlich ist, muss sie diese dann sozialversichern? Können Figuren einen Vertrag mit der Autorin kündigen, wenn dieser gegen die guten Sitten verstößt?
Wenn eine Autorin für ihre Figuren verantwortlich ist, muss sie diese dann sozialversichern? Können Figuren einen Vertrag mit der Autorin kündigen, wenn dieser gegen die guten Sitten verstößt?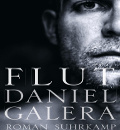 Oft ist das Toben von Naturgewalten die beste Beschreibung für das Leben eines Individuums.
Oft ist das Toben von Naturgewalten die beste Beschreibung für das Leben eines Individuums.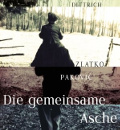 Der Begriff Antiroman lädt die Leserschaft ein, vor der Lektüre zu reflektieren, was mit dieser fiktionalen Antimaterie wohl angesprochen werden könnte.
Der Begriff Antiroman lädt die Leserschaft ein, vor der Lektüre zu reflektieren, was mit dieser fiktionalen Antimaterie wohl angesprochen werden könnte.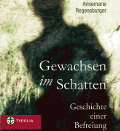 Was wie eine edle Herkunftsbezeichnung eines raren Weines klingt, hat bei der Beschreibung des eigenen Lebens natürlich schattige und dunkle Seiten.
Was wie eine edle Herkunftsbezeichnung eines raren Weines klingt, hat bei der Beschreibung des eigenen Lebens natürlich schattige und dunkle Seiten.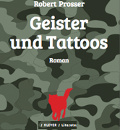 Obwohl es Wörter aus der üblichen Welt sind, erzählen sie unter dem Einfluss von Geistern und Tattoos eine Geschichte nicht von dieser Welt.
Obwohl es Wörter aus der üblichen Welt sind, erzählen sie unter dem Einfluss von Geistern und Tattoos eine Geschichte nicht von dieser Welt.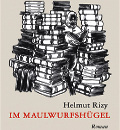 Wer etwas von der Welt mitbekommen will, muss sich von dieser manchmal abwenden.
Wer etwas von der Welt mitbekommen will, muss sich von dieser manchmal abwenden. Das Gebirge ist in der Literatur der Ort der letzten Klärung. Ob es sich nun um einen familiären Suizid handelt wie bei Thomas Bernhard oder um einen radikalen Hirnumschwung wie in Büchners Lenz, das Gebirge erscheint dabei als eine scharfe Klinge für die existenzielle Rasur.
Das Gebirge ist in der Literatur der Ort der letzten Klärung. Ob es sich nun um einen familiären Suizid handelt wie bei Thomas Bernhard oder um einen radikalen Hirnumschwung wie in Büchners Lenz, das Gebirge erscheint dabei als eine scharfe Klinge für die existenzielle Rasur.